Hier finden Sie Andachten und Predigten zu Lesen.
Wir danken besonders Pfarrer i.R. Eckhard Dierig dafür, dass er uns seine Texte und Bilder regelmäßig zur Verfügung stellt.
Pfarrer Dierig war bis vor vier Jahren Gemeindepfarrer in Kirchen/Sieg und hat in der Vakanzzeit zwischen Pfarrerin Köhler und Pfarrer Ott zusätzlich in unserer Gemeinde gewirkt. Heute lebt er mit seiner Familie in Norddeutschland und genießt es, nun Muße und Zeit zu haben um theologisch zu arbeiten. Gerne kombiniert er seine Texte mit Bildhaftem aus seinem reichen Foto-Archiv. Alle hier nicht namentlich gekennzeichneten Andachten/Predigten sind von Pfr. Dierig.
Damit Sie bei Interesse alle Texte nachlesen können, finden Sie die neuesten Texte immer oben, die anderen Texte wandern nach unten!
Predigten 2024
7. Sonntag nach Trinitatis 2024
Text: 1.Mose 8, 20-22
Liebe Leserinnen und Leser,
Der Herr sah hinab und sprach: „Es ist zu dumm!
Ich schuf die Menschen, doch ich weiß nicht mehr warum.
Seit dem ersten Tag gibt‘s Kriege nur und Mord,
ich schick‘ ein bisschen Wasser und ich spül sie alle fort.“
Der Herr stieg hinab, und als er auf die Erde kam,
da sah er Papa Noah, der sich ordentlich benahm.
So steht‘s geschrieben, so lesen wir es gern,
Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn.
Der Herr sprach: „Noah! Es kommt jetzt eine Flut,
zieh‘ die Jacke aus und setze ab den Hut,
nimm dir eine Axt, fang unverzüglich an:
Hol‘ Sem, Ham und Japhet, und bau‘ dir einen Kahn!“
Noah sprach. „Herr, ich glaub‘, das kann ich nicht.“
Der Herr sprach: „Noah, mach kein störrisches Gesicht.
Du weißt nie, was du kannst, bevor du es versuchst,
jetzt geh‘ und hole Bauholz, auch wenn du leise fluchst.“
Noah rief: „Herr, da ist sie, groß und schön!“
Der Herr sprach: „Noah, es wird Zeit, an Bord zu geh‘n.
Nimm von jedem Tier ein Paar ohne Makel und gesund
und Frau Noah und die Kinder und die Katze und den Hund.“
Noah sprach. „Herr, es fängt zu regnen an.“
Der Herr sprach. „Noah, bring die Tiere in den Kahn.“
Noah schrie: „Herr, es gießt in Strömen hier!“
Der Herr sprach: „Noah, geh rein!“ und schloss die Tür.
Die Arche stieg auf den Fluten empor,
und nach vierzig Tagen schaute Noah durch das Tor.
Er sprach: „Herr, wo sind wir, ich hab‘ das Schaukeln satt!“
Der Herr sprach: „Du sitzt auf dem Berge Ararat.“
Noah rief: „Herr, die Wasser rinnen fort!“
Der Herr sprach: „Noah, sieh den Regenbogen dort!
Bring alle Tiere und Menschen ans Licht,
seid fruchtbar und mehret euch und reizt mich nicht!“[1]
Dieses Lied wurde 1971 von einem Sänger namens „Bruce Low“ geschrieben und gesungen und war fast ein halbes Jahr ganz oben in der Hitparade. Die biblische Geschichte dahinter aus dem ersten Buch Mose ist bekannt: Weil die Menschheit nicht so lebte, wie es Gott gefiel, beschloss er, eine große Flut zu schicken. Aber es gab ein paar Menschen, die einigermaßen anständig lebten und Gott respektierten, nämlich Noah und seine Familie. Gott verschonte sie, indem er sie eine Arche bauen ließ, in der sie die Sintflut überlebten. Nach der Flut konnten sie die Arche verlassen, aber würde das Leben nun besser sein, wo es doch nur noch „gute“ Menschen gab?
„Noah fand Gnade in den Augen des Herrn“, heißt es im ersten Buch Mose, was darauf hindeutet, dass auch er nicht ganz ohne Fehler war, ebenso wie seine Familie Die Bibel berichtet später auch tatsächlich von zahlreichen Verfehlungen seiner Nachkommen.
Wir wissen, dass das Leben auch zu unseren Lebzeiten weder besser, noch sicherer, noch gottgefälliger geworden ist. Im Gegenteil: Viele Menschen haben Angst vor der Zukunft, und zwar aus vielfältigen Gründen, denken wir nur an die unabsehbaren Folgen des Klimawandels oder an die konkrete Bedrohung durch einen Krieg der von der Ukraine nach ganz Europa überschwappen könnte. Angesichts solcher realen Gefahren ist es gut, sich auf alte Glaubenswahrheiten zu besinnen. Drei möchte ich nennen:
– Wir sind vor Gott für unser Tun verantwortlich.
– Das Böse ist eine Realität in unserer Welt.
– Gott will, dass unser Leben gelingt.
Nach der Flut heißt es, dass Noah einen Altar für Gott baute und ihm Opfer darbrachte. Daraufhin sprach Gott:
„Ich will die Erde nicht weiter als verflucht betrachten, obwohl die Menschen schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ist böse von Jugend auf. Aber ich will nicht mehr alles Leben auf Erden vernichten, wie ich es getan habe. Vielmehr gilt: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“
Wir wissen nicht, wie die Frömmigkeit Noahs im Einzelnen ausgesehen hat. Aber offenbar hat er alles, was er erlebt hat, in Beziehung zu Gott gesetzt hat.
Christinnen und Christen leben heute ihren Glauben in unterschiedlichen Formen aus, mehr denn je ist der Glaube heute sehr individuell geprägt. Entscheidend ist jedoch nicht die äußere Form, sondern ob ich mein Leben überhaupt zu Gott in Beziehung setze, ob er in meinen Gedanken und Überlegungen überhaupt vorkommt. Bin ich nicht nur mir selber verantwortlich, sondern erkenne ich meine Verantwortung vor Gott?
Noah baut einen Altar, dankt und lobt Gott, dann erst geht er an die Arbeit.
Und wie reagiert Gott? Sein Bild von der Menschheit ist in dieser Erzählung sehr negativ. Ihr „Denken und Planen“ hält er von Grund an für böse. Natürlich kann man die Frage stellen, warum Gott die Menschen so und nicht anders, d.h. besser und friedlicher geschaffen habe, nur: Wo wäre dann der freie Wille des Menschen geblieben, der ihn vom Tier unterscheidet?
Heute wie damals gibt es unter uns rücksichtslosen Egoisten und skrupellose Verbrecher. Ebenso gibt es aber Menschen, die sich korrekt und solidarisch zu ihren Mitmenschen verhalten, und Christinnen und Christen sollten möglichst dazu gehören. Aber auch Menschen, die nicht nur an sich selber denken und die sich um ein gutes Verhältnis zu ihren Mitmenschen bemühen, müssen manchmal erkennen, dass auch ihr Verhalten nicht immer optimal ist. Sie erleben, dass auch sie schuldig werden oder zumindest anderen etwas schuldig bleiben.
Daran wird deutlich, dass jeder Mensch auf die Gnade Gottes angewiesen ist, einer der vier Grundsätze der Reformation.

Obwohl Gott in der Noah-Geschichte den Menschen mit all seinen Fehlern und Schwächen sieht, gibt er der Menschheit noch einmal eine Chance, ermöglicht er ihr einen Neuanfang. So wie ein Mensch, der sein Kind liebt, keine Freude daran hat, es zu bestrafen, sondern sich wünscht, dass seine Liebe erwidert wird. Darum heißt es:
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte,
Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“
Das ist eine großartige Zusage! Es heißt nicht: „Solange die Menschen sich einigermaßen benehmen…“, sondern: „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte…“ Als Zeichen für seine Zusage und den Bund mit Noah setzte Gott seinen „Bogen an den Himmel“: den Regenbogen!
Können wir uns also zurücklehnen und uns darauf verlassen, dass die ganz großen Katastrophen nicht eintreten werden? Sicher dürfen wir das nicht tun, denn wir dürfen mit Gott nicht spielen, ihn nicht provozieren oder ihn nicht ernst nehmen. Vielmehr sollten wir alles dafür tun, dass unserer Welt, die uns nicht gehört, sondern Gott, erhalten bleibt für unsere Kinder und Kindeskinder.
Gott wünscht sich den Menschen so, wie er ihn ursprünglich geschaffen hat: als sein Gegenüber. Er möchte eine lebendige Beziehung zum Menschen haben, aus der heraus dieser verantwortlich umgeht mit allem, was Gott ihm anvertraut. Bei allen Versuchen, das zu erreichen, auch bei allem Scheitern, dürfen wir wissen: Unser Leben und diese Welt stehen letztlich in eines Anderen Hand! In dieser Sicherheit dürfen wir uns „mit Herzen, Mund und Händen“ für Gottes gute Schöpfung einsetzen.
Dazu helfe uns Gott!
Amen.
[1] Das Lied-Text ist keinesfalls respektlos gegenüber dem Bibeltext, keine Verballhornung, sonst würde er hier nicht erscheinen. Vater und Großvater des Sängers waren Missionare, er selbst sang in seiner Jugend im Kirchenchor seiner Gemeinde. In seinen Liedern verarbeitete er sehr oft biblische Themen, zwar in einer recht lockeren Sprache, erreichte so aber viele Menschen.
Liebe Leserinnen und Leser,
Seit 2022 schreibt Pfarrer Dierig als Ruhestandspfarrer regelmäßig eine Predigt pro Woche, entweder eine, die er selber in der Wesermarsch hält oder eine extra für diesen Tag geschriebene. Es hat sich nun ergeben, dass Pfarrer Dierig ab August einen so genannten „Gastdienst“ in vier (!) Gemeinden in der Nähe seines Wohnortes übernimmt. Dazu gehören wöchentliche Gottesdienste, Beerdigungen, Trauungen, Begleitung von Gruppen usw. Dieser Gastdienst geht zunächst bis zum Ende des Jahres, vermutlich aber noch etwas darüber hinaus. Er schreibt dazu auch an die LeserInnen unserer Kirchengemeinde:
„Ich werde natürlich weiterhin an dieser Stelle eine Predigt pro Woche einstellen. Allerdings brauche ich oft viel Zeit dafür, entsprechende Fotos aus meinem Privat-Archiv auszusuchen. Ich habe mich deshalb schweren Herzens entschlossen, ab August bis auf Weiteres – von Ausnahmen abgesehen- auf Fotos zu verzichten. Sobald mein „Gastdienst“ beendet ist, werde ich meine Predigten wieder mit eigenen Fotos zur Unterstützung des Textes „anreichern“. Ich bitte um Verständnis für diese vorübergehende Maßnahme. Ihr Eckhard Dierig
4. Sonntag nach Trinitatis 2024
Text: 1. Samuel 18, 1-9
Liebe Leserinnen und Leser,
einen jungen Mann verbindet eine tiefe und innige Freundschaft mit dem Sohn seines Chefs, der dieser Freundschaft allerdings äußerst negativ gegenübersteht: Stoff für einen Kitsch-Roman oder einen Tatort, aber der Text, dem diese Thematik zugrunde liegt, ist Weltliteratur geworden. Er spielt vor ca. 3000 Jahren und ist in der Bibel überliefert.
Der eine junge Mann trägt den Namen Jonathan, und es geht um die Freundschaft mit niemand anderem als dem berühmten späteren König und Psalm-Dichter David. Vielleicht werden wir am Ende entdecken, dass es in dieser Geschichte auch noch um eine andere Freundschaft geht…
Im 18. Kapitel des ersten Buches Samuel heißt es:
Schon kurz nachdem David an den königlichen Hof gekommen war, fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Jonathan schloss daher einen Freundschaftsbund mit David und sagte: „Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben!“ Dabei zog er Mantel und Rüstung aus und bekleidete David damit, auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm.
David zog daraufhin für Saul in den Kampf und bewies eine glückliche Hand bei allem, was dieser ihm auftrug; darum gab ihm der König den Oberbefehl über seine Truppe. Als das Heer einmal siegreich mit David heimkehrte, zogen die Frauen ihnen entgegen und sangen: „Tausend Feinde hat Saul erschlagen, doch zehntausend erschlug David.“
Dieses Lied gefiel Saul gar nicht und er wurde sehr zornig. Er dachte: „David schreiben sie zehntausend zu, und mir nur tausend! Jetzt fehlt nur noch, dass er König wird!“
Von da an blickte Saul mit Argwohn auf David.
Verliebtsein ist ein Geschenk, aber dieses Geschenk muss man pflegen, damit es zur Liebe wird und Liebe bleiben kann: Diesen Satz gebe ich Brautpaaren oft mit auf den Weg. Mit einer Eheschließung sind in der Tat nicht alle Probleme ein-für-allemal gelöst, manch neue Herausforderung stellt sich sogar erst ein, wenn man tag-täglich zusammen ist. Beide Seiten müssen etwas dafür tun, damit das Geschenk des Verliebtseins nicht verpufft, sondern zu einer „stabilen“ Liebe wird. Wo die Bereitschaft dazu fehlt, hilft der Trauschein wenig, nicht einmal die kirchliche Trauung.
Was für die Ehe gilt, gilt abgeschwächt auch für jede Form von der Freundschaft. Die Freundschaft von David und Jonathan ist ein gutes Beispiel dafür. Sie beginnt schon bei der ersten Begegnung: Jonathan fühlt sich zu David hingezogen. Beide Männer haben einen guten „Draht“ zueinander! Das ist das Geschenk der Freundschaft, aber wie gehen sie damit um?
Die Bibel erzählt, wie sie ihre Freundschaft pflegen, und das ist in ihrem Fall wahrlich nicht einfach! Vor allen für Jonathan ist es unendlich schwer, denn er gerät immer wieder zwischen die Fronten zwischen seinem Vater Saul und seinem Freund David. Als er sich einmal bei Saul für David einsetzt, wird der Vater derart zornig, dass er Jonathan den „Sohn einer ehrlosen Mutter“ nennt und ihn mit einem Speer bedroht. Als Saul den jungen David töten lassen will, warnt Jonathan ihn, obwohl er damit praktisch seinen eigenen Anspruch auf den Thron aufgibt: Er ahnt, dass David der kommende König sein wird und nicht er selber. Damit ist Jonathan einverstanden und bittet David nur um eines, nämlich ihn später nicht zu vergessen…
Im Augenblick läuft die Fußball-EM in Deutschland. Viele erinnern sich bei dieser Gelegenheit an das Wort von Sepp Herberger: „Elf Freunde müsst ihr sein“. Wir brauchen aber nicht nur Freunde, um gut Fußball zu spielen oder um mit ihnen ein Bier zu trinken, zu grillen oder Party zu feiern.
Wir brauchen Freundinnen und Freunde, denen wir vertrauen können, mit denen wir in der Gewissheit, dass sie ein Geheimnis bewahren können, über unsere Sorgen und Freuden reden können, denen wir nichts vorspielen müssen, weil sie unsere Fehler kennen und uns trotzdem mögen, die ehrlich reden und liebevoll Kritik üben können. Ganz besonders hilfreich wäre es, wenn Freundinnen und/oder Freunde dabei wären, mit denen wir auch über unseren Glauben reden könnten, über Leben und Tod, über Gott und die Welt.
So gut uns eine Freundschaft tut, von Anderen wird sie nicht selten beargwöhnt. Ein frisch verliebtes Paar wird von seiner Umgebung oft misstrauisch bis argwöhnisch beobachtet: Was wird sich verändern? Werden andere Freundschaften aufgegeben? Verändern sich alte Freundschaften?
Bei einer so engen Freundschaft wie zwischen David und Jonathan wird sicher auch Mancher am Hof solche Gedanken gehabt haben. In ganz besonderer Weise missfällt die Beziehung aber dem König. Saul ist eifersüchtig auf das gute Verhältnis seines Sohnes zu David, der dann später nicht nur sein Nachfolger, sondern auch noch sein Schwiegersohn werden sollte… Es wäre schön, wenn alle Freundschaften so offen und ehrlich wären, wie die Freundschaft dieser beiden jungen Männer. Keinem Menschen wollten sie mit ihrer Freundschaft schaden, aber das sahen leider nicht Alle so…
Auch in einer Gemeinde sind Freundschaften sinnvoll und nützlich für die Gemeinschaft. Unser Anspruch ist ja sogar noch größer, als „nur“ Freunde zu sein, wir nennen uns ja sogar „Schwestern und Brüder“. Schön wäre es, wenn es bei „Kirchens“ viele solcher Freundschaften gäbe, durch die wir uns gegenseitig stärken und Mut machen könnten. Ein freundschaftlicher Umgang müsste eigentlich schon deshalb gegeben sein, weil es doch das gemeinsame Ziel aller Gruppen und Mitarbeitenden in einer Gemeinde sein sollte, der „Welt“ etwas von der Liebe Gottes zu sagen, einzuladen zum Glauben und zur Gemeinschaft mit IHM.

Manchmal sieht die Realität in unseren Gemeinden allerdings anders aus: Da gibt es Eifersüchteleien, wer was am besten macht und Beschwerden über das, was die Anderen angeblich falsch machen. Ein solches Verhalten ist absurd, wenn sich auch keiner ganz davon freisprechen kann…
Und damit zu einem letzten Gedanken bezüglich der Freundschaft: Gott selber ist es, der uns seine Freundschaft anbietet: Grundsätzlich und immer tut er das, aber an den „Nahtstellen des Lebens“ wird sie besonders erfahrbar:
In der Taufe sagt er dem Täufling: „Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich will dein Freund sein in allen Lebenslagen.“
Im Abendmahl lädt er ein: „Komm an meinen Tisch, es ist alles bereit, erfahre wie freundlich ich bin. Ich will deine Schuld vergeben und Gemeinschaft mit dir haben.“
Im Vaterunser bietet Jesus uns viel mehr als nur ein freundschaftliches Verhältnis zu Gott, denn wir dürfen ihn unseren „Vater“ nennen, also seine Kinder sein.
In Jesus Christus schenkt Gott uns dann das Wichtigste und Wertvollste, was er hat, um uns zu seinen Freunden zu machen.
Sollte uns als Christinnen und Christen das große Angebot der Freundschaft Gottes nicht verbinden, wie es David und Jonathan verbunden hat?
Als Gemeinde und als Einzelne dürfen wir uns immer wieder ins Bewusstsein rufen: Niemand kann uns etwas anhaben, wenn wir das Freundschaftsangebot Gottes annehmen und danach leben.
Amen.
3. Sonntag nach Trinitatis 2024
Text: Lukas 19, 1-10
Liebe Leserinnen und Leser,
Ein alter Mann wohnte an einem einsamen See. Ein anderer, ebenfalls nicht mehr ganz junger Mann wohnte in einiger Entfernung am Waldrand.
Im Herbst wurde der Mann am See schwer krank. Da kam der Mann vom Wald, besuchte ihn und brachte ihm ein kostbares Geschenk.
Der Mann am See freute sich darüber. Bald wurde er wieder gesund. Zur Weihnachtszeit traf’s den Mann am Waldrand. Krank lag er in seiner Hütte. Jetzt war es umgekehrt. Wenn auch langsamen Schrittes, so kam doch jeden Tag der Mann vom See zum Waldrand herauf und besuchte den Kranken. Täglich brachte er ein Geschenk mit, jeden Tag das gleiche. Und es war genau dasselbe, das sein Freund ihm im Herbst mitgebracht hatte. Schließlich konnte auch der Mann am Waldrand das Bett wieder verlassen. Die beiden Männer gingen hinaus, wanderten geruhsam ein Stück Wegs durch den Wald oder am Ufer des Sees entlang. Beide empfanden tiefe Freude über das Geschenkte.
Was war’s, was sie sich gegenseitig brachten? Sie hatten es in keinem Geschäft gekauft, denn man kann es gar nicht kaufen. Es wird auch nicht eingehüllt in buntes Seidenpapier. Die beiden Männer trugen es nicht bei sich, wenn sie sich besuchten, sondern in sich. So konnten sie es nicht verlieren. Es war ein so großes Geschenk, dass kein Stück Papier der Welt ausgereicht hätte, es darin einzuschlagen.[1]
Vermutlich haben Sie längst erraten, um welches Geschenk es sich handelte: Es war natürlich die Freundschaft. Freundschaft beinhaltet, dass man den Anderen besucht, in sein Haus einkehrt, gern mit ihm zusammen ist, sich mit ihm unterhält, seine Zeit mit ihm teilt, sich über seinen Besuch freut, ihn als Gast willkommen heißt und gut bewirtet.
Im 9. Kapitel des Lukasevangeliums wird von einem Mann berichtet, der eine solche Freundschaft bislang nicht kannte, sie vermutlich in seinem ganzen Leben noch nie wirklich erlebt hatte. Lukas schreibt:
Eines Tages kam Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum; Jesus musste dort vorbeikommen, und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können.
Als Jesus tatsächlich an dem Baum vorüber kam, schaute er hinauf und rief: „Zachäus, komm schnell herunter! Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein.“
So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab, und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf.
Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. „Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen!“, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte „Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.“
Da sagte Jesus zu Zachäus: „Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.“
Zunächst muss man sich klarmachen, wie sehr Zachäus sich nach Freundschaft gesehnt haben wird. Als Oberzöllner gehörte er sicher zu den reichsten Menschen der Stadt, aber zugleich auch zu denen, die man am meisten hasste. Keiner wollte mit ihm etwas zu tun haben, weil er mit den Römern zusammenarbeitete, den Feinden des jüdischen Volkes. Außerdem nahm er an Zollgebühren von Armen wie Reichen viel mehr, als ihm eigentlich zustand. Wenn er auftauchte, wichen die Menschen zurück. Freundschaft wird er vermutlich in seinen ganzen Leben nicht erlebt haben. Vielleicht haben die Menschen ausgespuckt, wenn sie ihn gesehen haben, vielleicht fielen böse Worte, die ihn schmerzten. Jedenfalls wird ihn niemand eingeladen haben, und wenn er ausnahmsweise eine Einladung aussprach, nahm sie niemand an und er blieb allein. Seine Kinder wurden von anderen Kindern gemobbt und seine Frau von ihresgleichen geschnitten. Äußerlich gesehen hatte Zachäus Alles, in seinem Inneren aber war er ein armer Mann.
Jeder Mensch braucht Freunde. Der vermeintlich Mächtige braucht sie und der vermeintlich Schwache: So reich Zachäus auch ist, er sehnt sich danach, dass ihn jemand einlädt, auf ihn zugeht, ihn anspricht, ihn ernst nimmt, ihn wie einen ganz normalen Menschen behandelt.
Jesus ist scheinbar der erste und bislang einzige, der tut das. Anders als die anderen Menschen in der Stadt bietet er Zachäus seine Nähe an, seine Freundschaft.
Auch heute bietet uns Gott seine Nähe, seine Zeit und seine Freundschaft an. Wir müssen dazu auf keinen Baum klettern, sondern ihn lediglich einlassen in unser Leben, unser Herz.

Freundschaft will gepflegt sein, sagt man. Man muss sich um eine Freundschaft bemühen. Das bedeutet in erster Linie, für den Anderen oder die Andere Zeit zu haben, für ihn oder sie da zu sein. Das wichtigste Geschenk im Rahmen einer Freundschaft ist nicht die mitgebrachte Flasche Wein, nicht das Buch zum Geburtstag, auch kein selbstgeschriebenes Gedicht. Vielmehr ist das Wichtigste die Zeit, die ich mir für den Anderen nehme.
Jesus schenkt dem Zöllner seine Zeit, was für Zachäus wertvoller ist als ein Sack voll Silberstücke. Geld hatte der Zöllner ohnehin, was ihm aber keine Lebensqualität einbrachte. Jesus nimmt sich Zeit für ihn, so wie er sich für uns Zeit nehmen will. Zachäus bekommt ein großartiges Geschenk: Jesus schenkt ihm nicht nur ein paar Minuten seiner Zeit, sondern verbringt sogar einen ganzen Abend mit Ihm und seiner Familie.
Dieses Geschenk ist entscheidend für das weitere Leben von Zachäus. Seine Leben macht eine Wendung um 180 Grad. Er braucht keinen Glaubenskurs, keine Einführung in den christlichen Glauben. Die Person Jesu allein überzeugt und überwältigt ihn.
Jesus schenkt Zachäus seine Zeit, ganz so wie Gott uns Zeit schenkt, Zeit um zu arbeiten, zu lieben, auszuruhen und Freundschaften zu pflegen, mit anderen Menschen und mit ihm selbst.
In unserer Geschichte am Anfang ging es um die Freundschaft zweier alter Männer. Vielleicht waren sie aus derselben Gegend, demselben Ort, kannten sich möglicherweise schon lange, wurden sich nur des Wertes ihrer Freundschaft neu bewusst. Freundschaft kann jedoch Grenzen sprengen, Grenzen die man zuvor für unüberwindbar gehalten hatte.
Vor 10 Tage wurde von ehemaligen Kriegsgegnern der D-Day begangen in Erinnerung daran, dass vor 80 Jahren die Alliierten mit 150.000 Soldaten in der Normandie gelandet waren, ein wichtiger Schritt, um West-Europa in blutigen Kämpfen von der Nazi-Herrschaft zu befreien. Mit den meisten der damaligen Gegner Deutschlands sind wir heute freundschaftlich verbunden, was damals wohl kaum jemand für möglich gehalten hätte. Während Freundschaft, auch und gerade zwischen unterschiedlichen Ländern, immer eine Bereicherung ist, gibt es im Krieg nur Verlierer.
Oder denken wir an die Ökumene: Wo vor Jahrhunderten noch blutige Feindschaft herrschte, wächst schon seit langem Freundschaft und Vertrauen. Christinnen und Christen haben verstanden, dass ihr Zeugnis in der Welt nur dann glaubhaft ist, wenn sie nicht gegeneinander, sondern miteinander auftreten. Das bedeutet nicht Gleichmacherei, aber es bedeutet, gemeinsam in die gleiche Richtung zu gehen, gemeinsam zu leben von der großen Freundschaft, die Gott uns anbietet.
Die Freundschaft Gottes kennt keine Grenzen: Sie gilt allen, die sich auf sie einlassen. Möge unsere Freundschaft der Freundschaft Gottes immer mehr gleichen!
Amen.
[1] W. Hoffsümmer: „Ein Weihnachtsrätsel“
1. Sonntag nach Trinitatis 2024
Text: Psalm 139 i.A.
Liebe Leserinnen und Leser,
in meiner Schulzeit brachte unser Pfarrer eines Tages ein neues Lied mit in den Schulgottesdienst. Es stammte aus einem kleinen Heftchen mit christlichen Liedern, das man aus der DDR herausgeschmuggelt hatte. Das Lied hat damals in mir großes Erstaunen und Erschrecken ausgelöst: Das haben Menschen geschrieben und gesungen, die für ihren Glauben und vielleicht auch für das Singen dieses Liedes Schwierigkeiten und Repressalien in Kauf genommen hatten. Für Jugendliche meines Alters bedeutete in der DDR die Konfirmation etwa, nicht studieren zu dürfen…
Das Lied von damals trägt den Titel „Ich sitze oder stehe…“. Jeder Vers hat zwei unterschiedliche Teile: Der erste Teil ist schnell, in Moll gehalten, abgehackt, dagegen besteht der zweite Teil, der Refrain, aus einer eingängigen sanften Melodie in Dur gesetzt…
Ich bin überzeugt, dass diese beiden unterschiedlichen Teile nicht nur die Situation von Christinnen und Christen der damaligen DDR widerspiegeln, unter Druck von außen, aber auch getröstet und gestärkt durch den Glauben und die Gemeinde vor Ort, sondern auch zugleich eine stimmige Interpretation des heutigen Predigttextes sind. Dieser Besteht aus Worten des 139. Psalms. Sein „Spitzensatz“ lautet nämlich wie der Refrain des erwähnten Liedes: „Von allen Seiten umgibst du mich, o Herr.“
Der 139. Psalm hat m. E. wenig Bedeutung für Menschen, für die Gott nicht existiert oder für die er zu einer bloßen Idee geworden ist. Wer so denkt, wird sich kaum Gedanken darum machen, wie Gott seine Gegenwart und sein Leben beeinflusst. Genau darum geht es aber im 139. Psalm. Es ist ein Psalm für Menschen, die Gott trotz Anfechtung und Zweifel noch nicht abgeschrieben haben:
Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es und verstehst meine Gedanken von ferne. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich; zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte.
Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen, wohin fliehen, um deinem Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort! Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen – dort wärst du auch!
Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin, es erfüllt mich mit Ehrfurcht.
Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott, es sind unbegreiflich viele!
Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht; prüfe mich und erkenne meine Gedanken! Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat!
In diesem Psalm finden sich die beiden Seiten Gottes, die im Leben eines Christenmenschen oft als sehr unterschiedlich wahrgenommen werden.
Die eine Seite Gottes beschreibt der Psalmist als etwas auf den ersten Blick Bedrückendes und Belastendes: Wohin könne er vor Gott fliehen, so fragt er sich im Laufe des Psalms.
Dabei kommt mir das Bild eines Aufpassers in den Sinn, jemand, der Andere auf Schritt und Tritt beobachtet. Journalisten geht es oft so, wenn sie in einem totalitären Staat unterwegs sind: Es wird ihnen ein Aufpasser an die Seite gegeben, der jeden Schritt überwacht und bestimmt, wohin man gehen darf mit wem man reden darf und mit wem nicht. In seinem Buch „1984“ beschreibt George Orwell eine Zeit, in der jeder Bürger ständig und in allen Lebenssituationen überwacht wird, um die Treue zur allmächtigen Regierung zu gewährleisten. In jedem Raum gibt es dazu das Auge des „Großen Bruders“, der alle Untertanen beobachtet. Die Schwarz-Weiß-Verfilmung des Buches aus dem Jahr 1953 geht einem auch heute noch „unter die Haut“. Interessanterweise war das Buch in der DDR verboten und das Lesen wurde mit die drei Jahren Haft bestraft…
Heute erleben wir in China eine fast ähnliche Überwachung auf Straßen und Plätzen… Und wissen wir, wie wir „überwacht“ werden, durch das, was „das Internet“ alles über uns weiß?
„Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen, wohin fliehen, um deinem Blicken zu entgehen?“
Die Nähe Gottes, auch wenn sie nicht mit Gewalt einhergeht, ist dem Psalmisten offenbar zu viel geworden. Immerhin hatte er ein Gespür für Gottes Allmacht, für Gottes völliges Anderssein, für seine Unverfügbarkeit. Die Folge war auf jeden fall so etwas wie Respekt, Gottesfurcht könnten wir sagen. Heute ist eine solche Gottesfurcht weitgehend verschwunden. Luther schrieb noch: „Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.“ Was passiert, wenn aus von diesen drei Verben das erste weglassen? Haben wir überhaupt noch ein Gespür dafür, dass „Gegenwart Gottes“ die Begegnung mit dem Heiligen und Göttlichen, dem unbegreiflichen und unverfügbaren Schöpfer bedeutet?
Wir erinnern uns an Jona, der Gott auch nicht entfliehen konnte und sich im Bauch eines Fisches wiederfand. Er konnte Gott nicht entfliehen und nicht dem Auftrag, der Stadt Ninive den drohenden Untergang anzukündigen. Aber im Ringen mit Gott um den richtigen Weg erfuhr er auch eine andere Seite Gottes, nämlich seine Fürsorge und sein Erbarmen.
Die andere Seite Gottes, die neben Jona auch der Psalmist erfahren hat, ist Gottes schützende und liebende Hingabe an uns.
„Die innere Haltung des Dichters zeigt das Ineinander von ehrfürchtigem Staunen vor der unbegreiflichen Größe Gottes und zugleich von hingebender, vertrauensvoller Bindung an ihn.“
Gottes Nähe, gerade wenn wir sie ernst nehmen, hat ihren tiefsten Sinn darin, uns zu bewahren, zu beschützen und zu leiten. Jörg Zink hat das sehr schön umschrieben:
„Vater im Himmel,
wie schön, dass du mich siehst.
Du siehst mich, wenn ich Angst habe,
du siehst mich, wenn ich allein bin
und von großen Dingen träume
und von dem Leben, das vor mir liegt.
Wie in zwei großen Händen hältst du mich.
Ich bin darin geborgen wie ein Vogel im Nest.“
„Nest“ und „Familie“, das sind aussagekräftige Bilder: Gott weiß um uns, wie Eltern um ihre Kinder wissen, die sich um sie sorgen, für sie da sind, manchmal Dinge tun, die ihre Kinder erst später verstehen werden – wenn überhaupt. Was es bedeutet, Mutter und Vater zu haben, wird manchem leider erst spät in seinen Leben bewusst: die Sicherheit, dass da jemand immer für mich da ist, wieviel Unfug ich auch anstelle, wie oft ich auch scheitere und wie oft ich alle Erwartungen enttäusche.

Durch diese uns so angenehme Seite Gottes aber droht Gott unter der Hand zu einer schwachen, eigentlich kaum mehr wirklich notwendigen Größe zu werden. Wir können schlecht unterscheiden, dass Gottes Güte nicht Schwäche bedeutet, seine Liebe nicht Gleichgültigkeit, der freie Wille nicht Beliebigkeit.
In einem irischen Segenslied heißt es am Schluss
Bis wir uns mal wieder sehen,
hoff ich, dass das Gott Dich nicht verlässt.
Gott halte Dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust Dich nie zu fest.
Möge niemand meinen, im Namen Gottes Druck auf andere auszuüben, Gottes Sache ist das jedenfalls nicht. Ich wünsche uns vielmehr bei aller Ehrfurcht und allem Respekt vor Gott die Gewissheit Dietrich Bonhoeffers:
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Amen.
Trinitatis 2024
Text:: Epheser 1, 3-14 i. A.
Liebe Leserinnen und Leser,
vor einigen Jahren hatten wir es in „meiner“ alten Westerwälder Gemeinde mit einem sonderbaren Fall zu tun: Ein Haubergsvorsteher (Erklärung folgt später…) meldete sich und eröffnete uns, dass die beiden Kirchengemeinden noch einige Haubergsanteile besäßen. Jahrzehntelang war das in Vergessenheit geraten und niemand wusste mehr, ob die Anteile nun der evangelischen oder der katholischen Gemeinde gehörten. Es folgte ein jahrelanger Schriftverkehr mit den unterschiedlichsten staatlichen und kirchlichen Behörden, der sehr, sehr viel mehr Kosten verursacht haben dürfte, als die Anteile überhaupt wert waren. Am Ende einigten sich die beiden Kirchengemeinden darauf, den relativ geringen Wert von einigen hundert Euros in Ermangelung von Beweisen in ökumenischer Freundschaft zu teilen…
Diese Geschichte wäre eigentlich nicht weiter erwähnenswert, allenfalls als ein abschreckendes Beispiel für zu viel Bürokratie, vergeudete Zeit und herausgeworfenes Geld, wenn mir in diesem Zusammenhang nicht deutlich geworden wäre, was ein „Haubergsanteil“ eigentlich ist. „Die Haubergsgenossenschaft ist eine Spezialform einer Genossenschaft, bei der die Genossenschaftsmitglieder gemeinsam die forstwirtschaftliche Nutzung eines bewaldeten Gebietes übernehmen. Die Hauberge sind ungeteiltes und unteilbares Gesamteigentum der Genossenschaft. Die Anteile an der Genossenschaft können vererbt und verkauft werden. Jährlich werden die schlagreifen Flächen ausgewiesen und in Lose unterteilt.“
Was aber hat das mit dem heutigen Predigttext zu tun?
Beide Male geht es um einen Anteil, einmal an einem Berg, und einmal an der Welt Gottes. Dabei geht es im Predigttext, passend zum heutigen Sonntag Trinitatis (Tag der Heiligen Dreifaltigkeit), um einen dreifachen Anteil. Der Text steht im ersten Kapitel des Epheserbriefes. Dort heißt es:
Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt… Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden… damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt: der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat durch Jesus Christus… Durch dessen Blut sind wir erlöst und unsere Schuld ist uns vergeben. In seiner überströmenden Güte schenkte Gott uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen…
Durch Christus haben wir (auch) Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt nach seinem Plan und Willen. Denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind! Durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid.
Gottes Geist (schließlich) ist der erste Anteil unseres Erbes, Angeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten, was Gott uns versprochen hat: Er will will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil.
Gott gibt uns Anteil an Geistlichen Gaben
„Anteil zu haben“ bedeutet, nur ein Stück von etwas zu haben, etwa einen Anteil an einer Gesellschaft zu haben oder Anteil zu haben am Erfolg einer Aktion.
Christen haben also, laut Predigttext, Anteil an den vielfältigen Gaben, die Gott seiner Kirche geschenkt hat. Wohlgemerkt: Sie haben Anteil, nicht: Sie sollten oder könnten Anteil haben. Jeder Christenmensch ist so gesehen im Besitz geistlicher Gaben.
Was aber sind geistliche Gaben? Die katholische Kirche nennt sieben Gaben: Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Andere nennen noch zusätzlich Prophetie, Glaube, Trösten können, Singen usw. Wieder Andere sagen, dass es so viele unterschiedliche Gaben gibt, dass man sie gar nicht alle aufzählen könne.
Angeblich wissen viele Christinnen und Christen aber nicht, welche Gaben sie eigentlich besitzen. Das ist sehr schade, denn nur wenn ich mir darüber im Klaren bin, kann ich entscheiden, ob ich diese Gaben für die Allgemeinheit, für Gemeinde und Kirche, einsetzen will.
Unser Anteil an den Gaben des Geistes wird zurückgeführt auf Gott, den Schöpfer. Wir singen im Gottesdienst oft ein Lied, in dem es heißt: „Vergiss es nie, dass du lebst war eines Anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich.“ Gott hat uns das Leben gegeben, daran glauben wir, und haben damit Anteil am Leben. Das aber haben alle Menschen, denn alle sind Geschöpfe Gottes. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle Menschen auch „Kinder“ Gottes sind. „Kinder“ Gottes sind die, die sich ihm anvertrauen, an ihn glauben und aus diesem Glauben heraus ihr Leben gestalten. Nur ihnen wird zugesagt, dass sie Anteil am Heil Gottes haben, das Gott zwar allen Menschen anbietet, aber nicht aufdrängt. Ob wir es annehmen, ist allein unsere Sache. Im Übrigen gilt auch von den geistlichen Gaben: Sie sind in der Gemeinde Christi immer zugleich auch Aufgaben!
Christus gibt uns Anteil am Heil
Im Text heißt es, Gott habe uns durch Christus „sein Siegel aufgedrückt“, die Bestätigung dafür, dass wir sein Eigentum seien. Wörtlich übersetzt lautet der Text: „Ihr seid versiegelt worden durch den Geist der Verheißung.“

„Versiegelt“ hat man in früheren Zeiten Briefe.
Was bedeutet es, wenn man einen Brief versiegelt hat? Es bedeutet: Ich stehe für den Inhalt mit meinem Namen, meiner Unterschrift, meinem Siegel ein, ich bin selber der Autor, der Urheber des Schreibens, ich stehe mit meiner Autorität dahinter. Aber es bedeutet auch: Den Inhalt kann ich nicht zurücknehmen, wenn der Brief einmal abgeschickt ist.
Wenn Gott sein Versprechen an uns, seine Töchter und Söhne zu sein, versiegelt hat, dann kann das niemand aufbrechen und aufheben. Keiner kann uns darum aus der Hand Gottes reißen, nur wir selber als Adressaten könnten das tun. Übersetzt bedeutet es: Keiner kann uns das Heil nehmen, das Christus für uns erworben hart, wenn wir es nicht selber wegwerfen, was Gott verhindern möge!
Der Geist gibt uns einen ersten Anteil am himmlischen Erbe…
Stellen wir uns einmal Folgendes vor: Ein Mensch vermacht in seinem Testament einen Teil seines großen Vermögens seiner Kirchengemeinde. Davon unterrichtet er die Gemeinde schon zu Lebzeiten in schriftlicher Form. Weil die Gemeinde aber jetzt gerade unbedingt Geld braucht, um ein defektes Dach zu reparieren, überweist er ihr schon mal 20.000 Euro, den Rest bekommt sie später, wenn das Testament eröffnet wird.
Was würde das für die Gemeinde bedeuten? Sie stände schon jetzt nicht mehr mit leeren Händen da, sie könnte ihre Arbeit tun, und wüsste, dass sie zu den Erben gehört und mit noch wesentlich mehr Zuwendungen zu rechnen hätte.
Ganz ähnlich ist es mit dem „ersten Anteil“ am Erbe Gottes: Wir haben jetzt schon einen Teil davon, sind jetzt schon geröstet und haben Hoffnung auf eine Zukunft bei Gott. Wir wissen definitiv, dass wir Erben sind, und in den Genuss all dessen kommen werden, was uns verheißen ist: Gut Voraussetzungen, um nicht zu resignieren, sondern mitzuarbeiten am Reich Gottes auf Erden.
Übrigens: Unser Predigttext „spricht wörtlich nicht von Erben, sondern sagt, dass ‚wir (von Gott) ausgelost worden sind’, d.h. nach alttestamentlichem Sprachgebrauch: unseren (Los-) Anteil an der Verheißung und am Erbe des Gottesvolkes erhalten haben.“
Das erinnert mich zum zweiten Mal an die Haubergsgeschichte vom Anfang: Als ich damals den Haubergsvorsteher fragte, welches Stück des Hauberges denn uns gehöre, hat er mich darüber aufgeklärt, dass man grundsätzlich einen „Anteil X“ an dem betreffenden Hauberg habe, dass aber jedes Jahr neu ausgelost würde, welches konkrete Stück man wirtschaftlich nutzen dürfe. Vielleicht ist auch das ein Hinweis auf unser Gemeindeleben: Wir müssen nicht für alle Zeiten an der gleichen Stelle tätig sein, sondern je nach Alter, Geschlecht, Verfassung und Lust kann sich das im Lauf der Zeit durchaus einmal ändern. Wer mir 16 Jahren Helfer im Kindergottesdienst war, muss sich nicht er mit 65 ein „neues“ Arbeitsfeld suchen…
So oder so haben wir Anspruch auf das göttliche Erbe. Dieser Anspruch ist unwiderruflich, nicht weil wir selbst wie ein Fels in der Brandung stehen (Wer könnte das schon von sich sagen?!), sondern weil Gott uns darauf „Brief und Siegel“ gegeben hat.
Amen.
Pfingsten 2024
Text: Hesekiel 37, 1-14
Liebe Leserinnen und Leser,
Plötzlich spürte ich, wie Gott seine Hand auf meine Schulter legte. Dann wurde ich von ihm hochgehoben, und wir flogen durch die Luft in ein mir unbekanntes Tal. Dort lagen überall Knochen und Skelette von Verstorbenen herum. Gott flog mit mir durch das ganze Tal, dann fragte er mich: „Hey du, Mensch, was denkst du? Können diese Skelette wieder lebendig werden? Kann daraus wieder ein Mensch entstehen?“ „Keine Ahnung, Gott!“, war meine Antwort. „Aber du weißt es bestimmt, oder?“
Seit über 40 Jahren predige ich fast jeden Sonntag, natürlich auch an jedem ersten und zweiten Pfingsttag. Das macht also etwa 80 Pfingst-Predigten. Der für heute vorgeschlagene Text, dessen ersten Teil Sie gerade gelesen haben, war allerdings noch nie dabei. Das liegt zum eine daran, das er erst seit einigen Jahren zu den vorgeschlagene Texten am Pfingstsonntag gehört. Zum andern liegt es daran, dass der Text in der Lutherbibel sehr drastisch dargestellt ist. Die Bilder könnten so bei manchen Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern eine gewisse Verstörung auslösen. Heute nun habe ich zu Vorbereitung eine „Übersetzung“ gefunden, die den alten Text wesentlich verständlicher macht und die weit weniger grausam klingt (Volx-Bibel). Deshalb- und weil der Text ein sehr passendes Bild von Kirche und Gemeinde zeichnet, ist er Grundlage der heutigen Predigt.
Bei der hier beschriebenen Vision eines Propheten namens Hesekiel handelt es sich zunächst um ein Bild für das Volk Israel, das Volk Gottes, das sich damals offenbar in einem beklagenswerten Zustand befand. Aber seit Jesus Christus in die Welt gekommen ist, gehört auch die Christenheit zum Volk Gottes, und darum sind auch wir hier gemeint.
Unter diesem Gesichtspunkt kann ich in dem ersten Teil des Predigttextes so etwas wie eine „Diagnose“, eine Art Zustandsbeschreibung unserer gegenwärtigen Kirchen erkennen, denn auch da gibt es vieles, was, wenn überhaupt, nur noch wenig lebendig erscheint. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass heute fast alle Kirchen für die normalen Gottesdienste viel zu groß sind. „Früher war mehr Kirche“ könnte man in Anlehnung an ein Loriot-Zitat sagen. Relativ viele Konfirmandinnen und Konfirmanden waren in den ersten Monaten des Jahres in den Gottesdiensten, nach der Konfirmation ist das meist vorbei, wir sind meist wieder „unter uns“, erleben meist einen realistischen, d. h. sehr geringen Gottesdienstbesuch.
Den Predigttext könnte man daher als Aufforderung verstehen, ehrlich und selbstkritisch zu sein: Der Gottesdienstbesuch geht zurück, ebenso die Anzahl an Trauungen und Taufen, die Austrittszahlen sind hoch und die Kirchensteuereinnahmen sinken. Was bleibt, sind die wunderschönen aber toten Gebäude, von denen wir bald viele nicht mehr werden unterhalten können.
Kann unsere Kirche jemals wieder lebendig werden? Wir müssen bei dieser Frage wohl die Schultern zucken und sagen: Keine Ahnung…
Wenn der Predigttext hier enden würde, wäre es heute ein sehr traurige Pfingstpredigt. Aber zum Glück geht er weiter.
Der Prophet berichtet, Gott habe ihm gesagt:
„Ich will, dass du mit der Autorität eines Propheten zu diesen Knochen sprichst. Sag zu ihnen: ‚Hört gut zu, was Gott euch zu sagen hat! Er wird dafür sorgen, dass an den Knochen wieder Sehnen und Muskeln wachsen.’“
Und der Prophet fährt fort:
„Also tat ich, was Gott mir gesagt hatte. Ich redete mit der Autorität eines Propheten zu diesen Knochen. Ich hatte noch nicht mal zu Ende gesprochen, da hörte man plötzlich ein heftiges Geräusch, das immer lauter wurde. Die Knochen fügten sich wieder so zusammen, wie sie zusammengehörten! Jetzt konnte man sehen, wie sich neue Sehnen und Muskeln an den Knochen formten. Dann wuchs auch neue Haut über das Fleisch. Aber am Ende lagen die fertigen Körper tot auf der Erde, denn es war noch kein Leben in ihnen.“
Auch hier fällt es nicht schwer, eine Parallele zu unseren Gemeinden, zu unserer Kirche zu finden. Dass es nicht gut aussieht mit der Kirche in unserem Land, haben wir zu Anfang schon gehört. Aber nun ist es keinesfalls so, dass alle bei „Kirchens“ die Hände in den Schoß legen. Schon seit Jahren werde Maßnahmen diskutiert und z. T. auch umgesetzt, um die Kirche auch für jüngere Menschen wieder attraktiver zu machen. Und tatsächlich gibt durchaus auch ein paar positive Aspekte:
Die Beteiligung an den Wahlen zu den Gemeindekirchenräten ist zumindest in unserer Region im Verglich zur letzten Wahl durch elektronische Wahlmöglichkeit und Verschickung von Briefwahl-Unterlagen an alle Gemeindeglieder erheblich gestiegen.
In vielen größeren Kirchen kann man auch spenden, wenn man kein Kleingeld zur Hand hat, nämlich mittels EC-Karte, und auf Initiative des Kirchenkreises wird sich eine Energiegemeinschaft gründen, um die Kirchen mit preiswerter Energie zu versorgen und die Gebäude klimaneutral gestalten zu können.
Aber ist das alles? Schließlich gibt es solche oder ähnliche Bemühungen schon seit vielen Jahren. Das ist wieder genau wie bei Hesekiel: Da ist nun wieder Fleisch an den Körpern, es sieht wieder besser aus, ist aber leider immer noch ohne Leben. Gut, dass es noch einen dritten Teil des Predigttextes gibt. Gott sagt demnach zu dem Propheten:
„Hey du, Mensch! Jetzt sprich mit der Autorität eines Propheten zu der Kraft, die etwas Totes lebendig macht. Sag: ‚Gott, der Chef vom ganzen Universum, befiehlt dir: Du sollst jetzt aus allen Richtungen gleichzeitig auf diese toten Körper kommen! Puste sie an und mach sie wieder lebendig!‘“
Und der Prophet fährt fort:
Ich zog alles genau so durch, wie Gott es mir gesagt hatte. Und tatsächlich kam die Kraft in die Körper, und sie wurden wieder lebendig,
Dann erklärte mir Gott: „Diese Skelette und Knochen stehen für die Leute von Israel. Die sagen von sich ja gerade: ‚Wir sind am Ende, unsere Knochen tun uns weh, wir haben keine Hoffnung mehr, wir sind verloren, unsre letzte Stunde hat geschlagen.‘ Darum musst du ihnen in meinem Namen sagen: ‚Passt auf, ich hole euch, meine Leute, dort raus. Ich werde euch nach Hause bringen, Ihr werdet kapieren, dass ich Gott bin, wenn ich euch aus dem Tod rausholen werde. Ihr seid doch meine Leute, ihr gehört zu mir! Ich werde euch meine Kraft geben und meine Power wird in euch reinfließen. Dann werdet ihr kapieren, dass ich zu euch gesprochen habe und dass ich das auch durchziehe, was ich ankündige.’“

Spätesten jetzt versteht man, was dieser Text mit Pfingsten zu tun hat. Wir erinnern uns an das, was wir eben in der Lesung gehört haben: Eine verängstigte Schar von Menschen wurde durch Gottes Geist buchstäblich begeistert, aus resignierten Jüngeren entstand eine weltweite Kirche.
Bei Hesekiel war das eine Vision, ein Bild, für das, was einmal sein sollte. Zu Pfingsten wurde diese Hoffnung erfüllt, wie schön!
Bleibt ein letzte, aber dafür entscheidende Frage: Was bedeutet das für uns?
Wir sollten erstens ehrlich sein, vor allem vor uns selbst, und dazu stehen, dass manches bei uns im Argen liegt. Zweitens sollten wir tun, was wir von uns aus vermögen, um den „Karren aus dem Dreck zu ziehen“, denn Pfingsten ist keine Ausrede fürs Nichtstun. Drittens und wichtigstes: Wir sollten dem Geist Gottes (mehr) Raum geben in unserem Leben, denn bei uns fängt Kirche an. Wir alle sind Kirche, nicht Kirche als Institution, sondern Kirche als „Gemeinschaft der Heiligen“, das sind Menschen, in deren Leben Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, eine Rolle spielt, ganz gleich zu welcher Konfession oder Gemeinde sie gehören. Heute wär die beste Gelegenheit, damit anzufangen.
Amen.
Exaudi 2024
Text: Epheser 5, 15-17
Liebe Leserinnen und Leser,
Ich war Gast im fremden Wagen. Mein Nachbar hatte mich über Land mitgenommen. Er saß mit Frau und Kind im Wagen und hatte es überaus eilig. Wir näherten uns einer kurzen, aber kurvenreichen Strecke. Ein Warnschild nach dem anderen. „Höchstgeschwindigkeit 50 Kilometer“, stand auf einem. Mein Nachbar nahm den Fuß nicht vom Gashebel. Erschrocken lese ich auf dem Tachometer: „80 … 90 … 100 … 130 … „Ich nehme allen Mut zusammen. „Weniger Gas!“ sage ich. „Haben Sie Angst?“ „Die Kurven!“ Mein Nachbar lacht: „Ich habe es eilig. Es kommt auf jede Minute an.“
Das ist ein Argument. Ich sage nichts mehr. Ich mache die Augen zu und erwarte mein Schicksal.
Es ist noch einmal alles gut gegangen.
Als wir weiterrollen, frage ich wie nebenbei: „Wie alt sind Sie?“ „Dreißig“, sagt mein Nachbar. „Da haben Sie das Leben noch vor sich. Noch mindestens 20 Millionen Minuten!“ „Ich rechne fest damit“, sagt er. „Wie alt ist Ihre Frau?“ „Zweiundzwanzig.“ „So herrlich jung! Da hat Sie voraussichtlich noch 25 Millionen Minuten zu leben. Und wie alt ist Ihr Kind?“ „Der Kleine? Vier Jahre!“, sagt er und lacht dem Kind glücklich zu. „Vier Jahre! Wie beneidenswert! 35 Millionen Minuten Leben liegen noch vor ihm.“

„Okay“, sagt er und sieht mich mit dummem Gesicht an, „warum erzählen Sie mir das alles?“
Ich sage: „Weil ich nicht verstehen kann, wie ein vernünftiger Mensch durch zu schnelles, unvorsichtiges Fahren zusammengerechnet 80 Millionen kostbarer Minuten riskiert, um eine einzige Minute zu gewinnen…“
Diese kleine Geschichte trägt den Titel „Jede Minute ist kostbar“. Dieser Titel kommt dem sehr nah, was im heutigen Predigttext so ausgedrückt ist: „Jeder Augenblick hat eine Chance in sich. Nutze sie.“ Und man könnte hinzufügen: „Und vertue sie nicht leichtfertig.“
Der Predigttext stammt aus dem Epheserbrief. Im fünften Kapitel heißt es dort nach der Übersetzung von Jörg Zink:
Tut die Augen auf! Seht auf euren Weg! Seht auf alles, was ihr tut, und tut es mit Sorgfalt und wachem Gewissen. Lebt nicht töricht in den Tag hinein, sondern seht euch die Welt an, in der ihr lebt, in die Gott euch gestellt hat.
Jeder Augenblick hat eine Chance in sich, nämlich die, dass der Glaube eine leibliche Gestalt finden kann in einem Wort oder in einer Tat. Nützt sie! Versäumt sie nicht! Denn es geschieht genug Böses in unseren Tagen.
Überlegt euch, was Gott euch aufgetragen hat, und handelt, wie es eurem Glauben entspricht. Denn weise handeln heißt, so leben, dass der Glaube sichtbar wird.
Martin Luther hat es in seiner Übersetzung so ausgedrückt: „Kaufet die Zeit aus!“ „Auskaufen“ bedeutet: Benutzt die Zeit in rechter Weise, nutzt sie richtig und vernünftig aus.
Zeit zu kaufen ist dagegen nicht möglich. Manchmal könnte man allerdings den Eindruck haben, dass sich diese Erkenntnis noch nicht überall durchgesetzt hat:
– In unseren Krankenhäusern wird nicht selten ein unumkehrbar zu Ende gehendes Leben weit über das Maß des Vernünftigen und Menschlichen hinaus verlängert…
– Es muss alles immer schneller gehen: die E-Mail hat den klassischen Brief ersetzt, das Flugzeug den Zug, und die Künstliche Intelligenz hat noch ganz andere Möglichkeiten, vor denen uns manchmal Angst werden könnte…
– Auf den Autobahnen wird gerast, obwohl eine moderate Geschwindigkeits-Begrenzung Menschenleben retten und Energie sparen würde…
Trotz alle dem oder vielleicht sogar wegen all dem kommen Menschen nicht selten in die Lage, nicht zu wissen, was sie dann mit ihrer freien Zeit dann Sinnvolles anfangen sollen…
Wir können uns keine Zeit kaufen, aber wir könnten die Zeit, die uns geschenkt ist, sinnvoll nutzen. Hören wir unter diesem Gesichtspunkt noch einmal den Predigttext
- Seht auf euren Weg! Unser Weg soll kein beliebiger, keiner in Sackgassen oder unwegsames Gelände sein. Und dabei sollten wir auch einmal darauf achten, wer denn neben uns geht…
- Tut die Augen auf! Vor dem, was um uns herum an Rechtem und Schlechtem geschieht, sollen wir die Augen nicht verschließen…
- Was ihr tut, tut mit Sorgfalt und wachem Gewissen. Wo immer wir gehen oder stehen ist Sorgfalt angesagt. Und ebenso wichtig ist ein Gewissen, das aufschreit, wenn Unrecht geschieht.
- Seht euch die Welt an! An was kann man sich nicht freuen oder ärgern, an was kann man nicht Anstoß nehmen, wofür sich nicht einsetzen?!
- Jeder Augenblick birgt die Chance, dass der Glaube zur Tat werden kann. Sind wir auf solche Augenblicke innerlich gefasst? Wie wird der Glaube zur Tat?
- Überlegt euch, was Gott euch aufgetragen hat. Die Frage ist nicht in erste Linie, was Gott generell von der Christenheit möchte, sondern was er hier und jetzt von mir will.
- Handelt, wie es eurem Glauben entspricht und
- lasst euren Glauben sichtbar werden…
Sind diese Aufgaben nicht zu schwer? Brauchen wir dazu nicht Zurüstung? Ja, aber Gott gibt sie ja. Im Eph. Brief heißt es einige Verse weiter:

Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht! Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält; Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt; dieses Schwert ist das Wort Gottes.
Gott gibt uns Waffen, nicht für eine Kampf mit Schwertern und Kanonen. Er rüstet uns vielmehr mit seinem Geist aus und schenkt uns und allen, die mit uns unterwegs sind, sein Wort für die geistlichen und geistigen Kämpfe unseres Lebens. Nehmen wir uns die Zeit, uns zu diesem Dienst zurüsten zu lassen.
Amen.
Rogate 2024
Text: Exodus 32, 7- 14
Liebe Leserinnen und Leser,
„Hör mal, Aaron“ sagte eines Tages Mose, der sein Volk mit Gottes Hilfe aus der Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hatte, „Hör mal Aaron, der Höchste hat mich heute zu sich gerufen. Er will mir die wichtigsten Regeln und Gebote geben, die er seinem Volk jemals gemacht hat. Ich muss da sofort hin, verstehst du, ich mach gleich auf den Weg.“
„Moment“, sagte Aaron zu seinem berühmten und und geachteten Bruder, „Moment, wie soll das gehen? Du bist unser Führer, Du weiß, wo es lang geht, ich bin nur dein Sprecher, dein Sprachrohr, sonst nichts. Entscheiden tust doch immer nur du, was mir übrigens auch ganz recht ist. Aber darum kannst du jetzt nicht einfach weggehen, egal wie wichtig das sein sollte.“
„Doch, ich kann,“ sagte Mose, „ich muss sogar gehen, denn Gott selber hat gerufen und ich werde gehen, weil es sein Wille ist… Es wird schon nichts passieren, und es wird auch nicht allzu lange dauern, bis ich wiederkomme. Solange bist Du als mein Stellvertreter für alles verantwortlich. Ich bin sicher, du schaffst das. Kopf hoch! Ich bin dann mal weg.…“
Damit holte Mose seinen Diener Josua, ließ den gleichsam fassungs- wie sprachlosen Aaron zurück und stieg hinauf auf den Berg Sinai, um Gottes Gebote in Empfang zu nehmen.

Aber anders als erwartet -und von Aaron sehnlichst erhofft-, kam Moses am Abend nicht zurück. Er blieb einen Tag, blieb zwei Tage, blieb zehn Tage, und Aaron wurde immer nervöser und das Volk immer unruhiger. Keiner wusste was los war mit Mose und seinem Gott. Diesen Gott hatte ja noch niemand zu Gesicht bekommen, und jetzt war Mose auch noch weg, wie sollte es jetzt weitergehen?
Die Männer kamen zu Aaron und sagten „Wir haben genug von Mose und seinen Extratouren. Wer weiß, ob er überhaupt noch lebt?! Wir brauchen einen Gott, den wir sehen können, den wir anfassen können, der hier in unserer Mitte ist.“
Aaron dachte: „Da haben wir den Salat! Was soll ich denn jetzt machen? Ich verstehe, was die Leute wollen, ich bin selbst unglücklich über die Situation und habe Angst. Aber ich kann doch keinen Gott aus dem Hut zaubern, was soll ich tun? Mose hätten sicher gewusst, das zu tun wäre, aber ich fühle mich von der Situation völlig überfordert.“
Er schickte die Leute mit einer Beschwichtigung weg: „Ich werde mal drüber schlafen, vielleicht ist Mose ja auch morgen wieder da…“ Aber er glaubte selber nicht daran, und Mose war auch am nächsten Tag nicht da. Die Leute bedrängten Aaron mit jeder Stunde mehr: „Gib uns endlich einen Gott, dem wir folgen können, den wir sehen!“
Aaron war verzweifelt. Er merkte, dass die Lage zu kippen drohte: Sein Leben war in Gefahr, und was noch schlimmer war: Die bisher so erfolgreiche Aktion „Auszug aus Ägypten“ konnte in einen Aufstand münden und scheitern, wo sie alle zusammen doch schon so weit gekommen waren.
Schließlich war Aaron so weit, dass er sich sagte: „Ich muss irgendetwas machen, alles ist besser, als nichts zu tun.“ Er ließ also die Anführer der Menge noch einmal kommen und sagte: „Wie ihr wollt: Bringt mir bis Morgen Abend alles Gold, das die Menschen bei sich haben, allen Schmuck und alle goldenen Gefäße…“
Es kam tatsächlich einiges zusammen. Aaron ließ alles einschmelzen und machte daraus eine Statue in Form eines goldenen Stierkalbs. Dann organisierte er ein großes Fest. Die Menschen waren begeistert, tanzten um das Kalb herum, beteten es an und feierten es als ihren Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte.
Natürlich blieb das alles vor Gott nicht verborgen. Er war maßlos enttäuscht von seinem Volk, das er doch so liebte. Mit schroffen Worten fuhr er Mose an:
Steig sofort vom Berg hinab, denn Dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, hat etwas Schlimmes getan: Sie haben sich tatsächlich ein goldenes Stierkalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen, ihm Opfer gebracht und gerufen: „Das ist unser Gott, der uns aus Ägypten hierher geführt hat!“
Da saßen sie nun also alle in der Klemme: Aaron, der sich diese Aufgabe beileibe nicht ausgesucht oder gar gewünscht hatte und der nur alles hatte richtig machen wollen; das Volk, das nur deshalb von Gottes Weg abgewichen war, weil es ängstlich und unsicher war; und Mose, der nun an allem schuld sein sollte: „Dein Volk“, hatte Gott gesagte, „Dein Volk hat gesündigt.“ War es bisher nicht immer das Volk Gottes gewesen? Mose fühlte sich total mies und hatte das Gefühl, unschuldig zwischen allen Stühlen zu sitzen. Aber es kam noch schlimmer, denn Gott fuhr fort:
Ich habe jetzt erkannt, wie eigensinnig dieses Volk ist. Versuch nicht, mich umzustimmen, Mose! Ich bin so zornig, dass ich sie alle vernichten werde. Mit dir allerdings will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen.“
Mose stand da wie erstarrt. Hatte er sich nicht auch immer wieder einmal über das Volk geärgert? Und jetzt dieses Angebot: Nur er und seine Familie sollten überleben und Gott würde für sie sorgen… Ein verlockendes Angebot, aber Mose war nicht wohl bei diesem Gedanken. So kannte er Gott bisher nicht, und so versuchte er, den Herrn umzustimmen:
Warum willst du dem Zorn über dein Volk freien Lauf lassen, Herr? Du hast es doch eben erst aus Ägypten herausgeführt! Du willst doch sicher nicht, dass die Ägypter von dir sagen: „Er hat sie nur aus unserem Land herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten.“ Bitte mach deinen Entschluss wieder rückgängig. Denk doch nur an Abraham, an Isaak und Jakob, denen du mit einem feierlichen Eid versprochen hast: „Ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel; ich will ihnen das Land, von dem ich zu euch gesprochen habe, für immer zum Besitz geben.“
Der heutige Sonntag trägt den Namen „Rogate“, das bedeutet: „betet“. Unser heutiger Predigttext ist ein gutes Beispiel für ein besonderes Gebet, nämlich das Fürbittengebet. Dabei bitten wir Gott wir nicht für uns selber, sondern für die Menschen, die Hilfe besonders nötig haben. Das Fürbittengebet steht am Ende eines jeden Gottesdienstes. Das Gebet für uns selber hat im Gottesdienst und außerhalb des Gottesdienstes natürlich auch seinen Platz und seine Berechtigung. Das Vaterunser etwa ist in weiten Teilen ein Gebet, das auf uns selbst bezogen ist: führe uns nicht in Versuchung, vergib uns unsere Schuld, gib uns unser täglich Brot…
Aber hier geht es eben um die Fürbitte, und da kann uns das Verhalten von Mose ein gutes Vorbild sein:
Fürbitte bedeutet, zum einen, sich einzusetzen für Andere, auch wenn es Konsequenzen für uns selber hat. Mose schlägt ein für ihn persönlich verlockendes Angebot aus, um sich für das Leben Anderer einzusetzen. Übersetzt könnte das heißen, dass es nicht zusammenpasst, wenn wir für die Opfer einer Katastrophe beten, am Ausgang aber bei der Sammlung für diese Menschen am Klingelbeutel vorbeigehen. Oder wenn wir für die Erhaltung von Gottes guter Schöpfung beten, aber selber in keiner Weise unser Leben danach ausrichten.
Fürbitte heißt zum anderen, nicht alles gutzuheißen, selbst wenn es das scheinbar Gottgewollte ist. Fürbitte zu halten muss einhergehen mit Freundlichkeit, Liebe und Barmherzigkeit, so dass Worte und Taten zusammenpassen.
Das Verhalten von Mose macht aber vor allem deutlich, dass wir Gott im Gebet alles sagen können, dass wir sogar mit ihm streiten können, zwar nicht auf gleicher Ebene wie er, aber doch als sein Gegenüber, das er ernst nimmt.
Die Geschichte endet übrigens mit den Worten:
Da änderte der Herr seinen Entschluss und ließ das angedrohte Unheil nicht über sein Volk hereinbrechen.
Das Verhalten der Menschen ist Gott nicht gleichgültig. „Es schmerzt ihn, wenn seine Liebe von seinen Geschöpfen nicht erwidert wird, […] und dennoch behält diese Liebe trotz aller Enttäuschung am Ende die Oberhand.“[1]
Zum Schluss noch ein Blick darauf, wie die Geschichte weiterging: Mose, der eigene Vorteile ausgeschlagen und sich für das Volk eingesetzt hatte, ging nicht einfach zurück und tat, als wäre nichts gewesen, im Gegenteil: Aaron wurde von Mose hart kritisiert und das Volk wurde bestraft.
Dieser Ausgang bewahrt uns davor, Tat und Täter zu verwechseln: Für jeden Menschen lohnt es sich, sich einzusetzen, auch und gerade im Gebet, selbst wenn das, was er getan hat, nicht in Ordnung war.
Amen.
[1] SEB zur Stelle
Kantate 2024
Text: Matthäus 11, 25-30
Liebe Leserinnen und Leser,
in diesem Monat haben meine Frau und ich einen zehntägigen Urlaub an der Ostsee, in dem kleinen Städtchen Kappeln an der Schlei, verbracht. Am letzten Sonntag waren wir dort im Gottesdienst. Es wurden überdurchschnittlich viele Lieder gesungen, schließlich war es der Sonntag „Jubilate“, d. h. „jubelt“, und versehentlich kam am Ende -zu unserer Freude- noch ein Lied dazu, das die Pfarrerin eigentlich gar nicht eingeplant hatte. Es waren alles Lieder, alte und neue, die meine Frau und ich gut kannten, und so haben wir kräftig und voll Freude mitgesungen. Meine Frau sagte am Ende des Gottesdienstes gut gelaunt: „So viel wie heute habe ich in einem Gottesdienst lange nicht mehr gesungen.“ Vor- und Nachspiel taten ein Übriges, um den Gottesdienst für uns zu einem sehr schönen Erlebnis zu machen. Natürlich gab es auch Lesungen, Gebete und eine Predigt mit Gedanken, die mich durchaus angesprochen haben, aber in Erinnerung geblieben sind mir neben der prächtigen Einrichtung der Kirche eigentlich nur die Lieder und die Orgel-Musik, die diesen Gottesdienst getragen und gestaltet haben.

Heute, eine Woche später, feiern wir den Gottesdienst „Kantate“. Es ist einer der wenigen Sonntage, bei denen man meistens noch weiß, was es damit auf dich hat: „Kantate“ bedeutet „singet“, eine Aufforderung also an die christliche Gemeinde, zu singen und zu musizieren, weil sie allen Grund hat, Gott damit zu loben.
Der heutige Predigt Text macht nun deutlich, worin dieser Grund besteht.
Der Evangelist Matthäus berichtet, Jesus habe einmal zu Gott gebetet:
„Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du vieles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast.“
Dann habe er zu der Menge gewandt gesagt:
Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn; und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn – und die, denen der Sohn es offenbaren will.
Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet; ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht.“
Zunächst lobt Jesus seinen himmlischen Vater dafür, dass der Glaube nicht in erster Linie durch Weisheit und Klugheit erlangt werden kann. Wenn das nämlich so wäre, wäre vielen Menschen der Zugang zum Glauben verwehrt. Wie gut, dass es so nicht ist. Trotzdem müssen wir in der Kirche unseren Glauben nicht „an der Garderobe abgeben“. Gott ist schließlich auch der Schöpfer unseres Geistes und unseres Verstandes.
Nicht selten wird ein Widerspruch zwischen Glauben und wissenschaftlichem Denken behauptet, eine Meinung, die ich nicht teilen kann. Nehmen wir als Beispiel unsere Erde: Auch Christinnen und Christen sind nicht der Meinung, dass sie auf Säulen ruhe, obwohl das so in der Bibel steht, und auch Christenmenschen setzen sich -wie Andere- für die Erhaltung unseres blauen Planeten ein. Aber entscheidend ist für Christinnen und Christen nicht die Frage, wie unsere Welt entstanden ist, sondern ob sie ein Produkt des Zufalls ist oder ob dahinter, in welcher Weise auch immer, der „Schöpfer des Himmels und der Erde“ steht, wie wir es im Glaubensbekenntnis aussprechen. Diesem Schöpfergott sind wir verantwortlich im Umgang mit seiner Schöpfung, die so oder so ein Wunder bleibt, am Ende so unerklärlich wie die Ewigkeit oder die Unendlichkeit.
In Fragen des Glaubens müssen wir nicht alles wissen und auch nicht alles glauben. Glauben müssen wir nur an einen, nämlich an Christus und seinen himmlischen Vater. Auch wenn es unterschiedliche Zugänge zum Glauben gibt, ein kindliches Urvertrauen zu Gott, ein allmähliches Hineinwachsen in den Glauben oder die als notwendig erkannte Bewahrung der bedrohten Schöpfung: Das Kriterium für den christlichen Glauben ist immer die Person Jesus Christus! Niemand kennt den himmlischen Vater, sagt Jesus, nur der Sohn und alle, die an ihn glauben.
Dem Wesen Gottes können wir uns daher am ehesten im Blick auf Jesus nähern. So wie er gelebt hat, so können wir uns das Wesen Gottes am besten vorstellen. Immerhin gibt es eine ganze Reihe von Berichten über das Leben Jesu, sodass wir uns ein Bild von ihm machen können, jedenfalls, was seinen Glauben betrifft. Wir können uns daher in allen Situationen unseres Lebens fragen: Was würde Jesus jetzt wohl gesagt oder getan haben? Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass man ganz falsch liegt, wenn man sich diese Frage stellt sich entsprechend verhält.
Am Ende spricht Jesus ein Einladung aus, die als so genannter „Heilandsruf“ bekannt geworden ist. In der traditionellen Luther-Übersetzung lautet diese Einladung so:
Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.
Um es vorweg zu sagen: Andere Menschen, glückliche und zufriedene, sind natürlich auch eingeladen, aber die bedrückten und geplagten sind es in besonderer Weise, weil sie es besonders nötig haben.
Gott bietet uns an, zur Ruhe zu kommen, er möchte uns „erquicken“ und wiederbeleben. Wodurch? Durch eine Pause im Alltagstrott, etwa den Sonntag oder den Gottesdienst. Aber sein Angebot umfasst noch mehr, etwa die Vergebung von Schuld oder die Chance auf einen Neuanfangs in verfahrenen Situationen.
Auf den ersten Blick klingt es da verwunderlich, dass Jesus von einem „Joch“ spricht, das er uns auferlegen möchte. Aber auf den zweiten Blick aber macht es durchaus Sinn, denn ein Joch ist ja nichts anderes als eine Hilfskonstruktion, mit der Körbe oder Eimer getragen werden können, viel einfacher als ohne dieses Hilfsmittel. Ein Joch ist also in erster Linie eine Entlastung. Darum kann Jesus sein Joch als „leicht“ bezeichnen.

Worin aber besteht es? Wir müssen nicht die Welt aus den Angeln heben, sondern Jesus nachfolgen, indem wir Gott lieben -und unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist das Joch, das wir auf uns nehmen sollen. Dass wir auch bei diesem vergleichsweise sanften Joch immer wieder scheitern, dass Anfechtungen und Glaubens-Zweifel uns bedrücken, ist kein Grund aufzugeben, denn gerade dann gilt uns ja Gottes Ruf: Kommt her zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen: Ich nehme euch an, so wie ihr seid: so stark oder schwach, so alt oder jung, so gläubig oder zweifelnd: Euch alle will ich erquicken, euch allen will ich Ruhe geben.
Dass uns allen dieser Ruf, diese Einladung gilt, das ist der schönste und tiefste Grund, zum Lob und zur Ehre unseres Gottes zu singen, nicht nur am Sonntag Kantate.
Amen.
Jubilate 2024
Text:: Johannes 15, 1-5
Liebe Leserinnen und Leser,
„Wein und Weinverwandtes gehören zu den am häufigsten benutzten Begriffen der Bibel: An weit über 300 Stellen wird vom Wein, vom Weinstock, vom Weinberg, vom Winzer, von der Traube, der Rebe oder der Kelter gesprochen. Der Wein erfährt über seine Behandlung als Nahrungs-, Genuss sowie Heilmittel und Opfergabe der Israeliten hinaus eine reiche symbolische Verwendung, und erhält schließlich durch Jesus eine… Würde, wie sie neben dem Brot keinem anderen von Menschenhand gewonnenen Naturprodukt zu Teil geworden ist. Die Behandlung des Weins in der Bibel hat unsere Kulturgeschichte nachhaltig beeinflusst und wirkt… bis zum heutigen Tage fort. Den zugehörigen biblischen Wurzeln nachzuspüren, ist daher von aktuellem Reiz…“
So heißt es im Einbandtext eines Buches mit dem Titel „Der Wein und die Bibel, Freude ohne Grenzen“.
 Auch die Deutsche Bibelgesellschaft bestätigt die wichtige Bedeutung des Weins sowohl als Lebensmittel wie auch als Symbol. Es hei0t dort unter dem Stichwort „Wein“: „Wein gehörte im Land der Bibel zu den alltäglichen Nahrungsmitteln. Meist wurde er mit Wasser vermischt getrunken und war ein wichtiges Getränk für die Bevölkerung dieses heißen Landes. In der Bibel bedeutet Wein aber oft mehr, nämlich Lebensfreude und Wohlstand. Er wird als Gabe Gottes bezeichnet, die den Menschen Freude bereitet. Im Zusammenhang mit den jüdischen Festen spielt der Wein eine wichtige Rolle und gehört unverzichtbar zum Passamahl.“
Auch die Deutsche Bibelgesellschaft bestätigt die wichtige Bedeutung des Weins sowohl als Lebensmittel wie auch als Symbol. Es hei0t dort unter dem Stichwort „Wein“: „Wein gehörte im Land der Bibel zu den alltäglichen Nahrungsmitteln. Meist wurde er mit Wasser vermischt getrunken und war ein wichtiges Getränk für die Bevölkerung dieses heißen Landes. In der Bibel bedeutet Wein aber oft mehr, nämlich Lebensfreude und Wohlstand. Er wird als Gabe Gottes bezeichnet, die den Menschen Freude bereitet. Im Zusammenhang mit den jüdischen Festen spielt der Wein eine wichtige Rolle und gehört unverzichtbar zum Passamahl.“
Jesus benutzt den Wein bzw. den Weinanbau oftmals in seinen Gleichnissen. Der heutige Predigttext ist dafür ein Beispiel. Nach dem Bericht des Evangelisten Johannes sagte Jesus einmal zu seinen Jüngern:
Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht trägt, schneidet er ab; eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück; so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein; ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt ihr nichts tun.
Auf den ersten Blick bzw. beim ersten Hören ist das Bild, das Jesus hier gebraucht, sehr einleuchtend: Eine Rebe kann nicht für sich selbst existieren, sie darf also nicht abgeklemmt werden vom Stamm, die „Kraftstoffzuleitung“ darf nicht unterbrochen werden…
Dennoch, beim zweiten Lesen kommen erste Fragen. Eine davon lautet, ob es auch in Sache „Glauben“ so etwas wie einen Leistungsdruck für Christinnen und Christen gibt.
Wir erleben in unserer Gesellschaft an vielen Stellen einen immer größer werdenden Leistungsdruck. Auch kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind davon betroffen.
Soll das nun auch für den Glauben gelten? Man könnte den Text so missverstehen, denn es heißt ja, eine Rebe, die keine Frucht bringe, werde abgeschnitten. Steht das nicht im Widerspruch dazu, dass der Glaube mir Freiräume ermöglicht? Sind mein Glauben, meine Zeit des Gebetes oder der Meditation, der Gottesdienst usw. nicht gerade Ruhezonen in meinem Leben?
Wenn wir das Bild vom Weinstock genau durchdenken, dann ist da nirgends davon die Rede, dass sich die Rebe besonders anstrengen muss. Es darf nur nicht dazu kommen, dass die Verbindung unterbrochen wird, dann komm der „Lebenssaft“ wie von selbst. Der Glaube hat nichts mit Leistungsdruck zu tun. Dennoch ist die Rede davon, dass Gott die Reben in die Lage versetzen will, mehr Frucht zu bringen. Aber das ist eben der entscheidende Unterschied: Nicht die Rebe tut etwas, sondern der Weingärtner, nicht wir als Menschen tun etwas, sondern Gott tut etwas, wir müssen es uns nur gefallen lassen.
Und das geschieht in unseren Gemeinden durchaus, wenn da auch noch etwas Luft nach oben ist:
Viel Menschen engagieren sich auch heute ehrenamtlich in Gemeinden und Kirchen bzw. kirchlichen Werken und Institutionen. Sie engagieren sich etwa in Presbyterien und Gemeindekirchenräten. Alle Posten konnten beispielsweise in meiner Wohnsitzgemeinde besetzt werden, und mehr als jedes dritte Gemeindeglied hat an der Wahl teilgenommen. Es gibt daneben ehrenamtliches Engagement bei Basaren, in Chören, beim Lektorendienst usw. Ohne Ehrenamtliche wäre die Arbeit der Kirche kaum noch möglich – jedenfalls nicht in der heutigen Form.
Und Hauptamtliche? Nicht wenige reiben sich auf in ihren Dienst auf und stellen viele persönliche Wünsche in den Hintergrund.
Wieso kann Jesus da sagen: „Ohne mich könnt ihr nichts tun?“
Bleibt den Bläsern die Luft weg, wenn sie ihre Übungsstunden nicht mit der Tageslosung beginnen? Gelingt die Dienstbesprechung nur, wenn eine Andacht vorausgeht?
Wir können schon etwas tun. Nicht alles ist sinnlos, auch dann nicht, wenn uns augenblicklich der unumstößliche Glaube fehlen sollte. Und sicher will uns der Text nicht demoralisieren, uns klein und unbedeutend machen. Worum aber geht es dann?
Das hierbei wichtige Begriff lautet „In Verbindung bleiben“.
„Wir bleiben in Verbindung…“ sagen wir oft am Ende eines Gesprächs oder wenn jemand wegzieht…. Wenn das nicht nur so daher gesagt wird, steckt dahinter der Wunsch und Wille: Die Verbindung soll erhalten bleiben.
Worin aber besteht die Verbindung zu Gott?

Vor allem darin, dass wir mit all unseren Fehlern, Macken, Zweifeln und Versagen ganz untrennbar zu ihm gehören, und zwar deshalb, weil er die Verbindung nicht kappen wird, wenn wir uns nicht bewusst von ihm lösen.
Christinnen und Christen sind ihr Leben lang Sünderinnen und Sünder, aber sie leben auch ihr Leben lang aus der Vergebung ihrer Schuld heraus. Ihr Leben lang gehören sie zu Gott – wenn sie wollen.
In der Taufe hat Gott uns eingeladen, aus dieser Verbindung heraus zu leben, zur Familie Gottes zu gehören. Sünde heißt nicht: Ich mache in diesem Familienverband etwas schlecht oder falsch, sondern ich will mit dieser Familie nichts mehr zu tun haben, ich kappe die Verbindung zum göttlichen Weinstock.
Jesus wirbt darum, die Verbindung zu Gott nicht zu kappen: Bleibt in Verbindung mit Gott lasst, die Verbindung nie abreißen, sondert euch nicht ab von Gott…
Der Weinstock ist ein schönes und einprägsames Bild. Es will uns zeigen, woher wir Kraft und Zuversicht nehmen können, so dass wir bei allem Elend dieser Welt sagen können: Gott hat den Tod überwunden, deshalb freut Euch und jubelt, lateinisch: „Jubilate!“ – der Namen des heutigen Sonntages!
Amen.
Miserikordias Domini 2024
Text: 1.Korinther 15, 1-5
Liebe Leserinnen und Leser,
„Ein österlicher Witz des katholischen Passauer Bischofs Stefan Oster entpuppt sich als Klick-Bringer. Bis Ostermontagabend gab es rund 400.000 Aufrufe, mittlerweile sind es über eine Million Klicks. Zudem gab es begeisterte Kommentare. Sie reichten von ‚Einfach klasse‘, ‚Es tut der Kirche gut, ein Lachen zuzulassen‘ bis ‚der Humor in diesen Kreisen der Kirche hat mich doch angenehm überrascht‘.
Oster hatte im diesjährigen Ostergottesdienst… für große Heiterkeit gesorgt. Grund war ein von ihm vorgetragener Witz am Ende der Feierlichkeiten in der Tradition des Osterlachens… Im Mitschnitt… ist nicht nur das Lachen der Gottesdienstbesucher zu hören, sondern auch zu sehen, wie der Bischof selbst und sein Altardienst immer wieder von Lachanfällen gebeutelt werden…

Osterwitze haben eine lange Tradition: Sie sind seit dem 9. Jahrhundert … belegt. Aus Sicht der Kirche ist die Auferstehung Jesu als höchstes Fest der Kirche ein Grund für überschwängliche Freude. Diese Freude sollen auch die Osterwitze verbreiten.“
So berichtet Anfang des Monats der Bayrische Sender BR24. Kirche und Fröhlichkeit, Lachen im Gottesdienst, das passt für die Christenheit in Mitteleuropa scheinbar nicht zusammen, und wenn es ausnahmsweise doch einmal geschieht, ist das Staunen groß.
Da wird auch berichtet, dass ein Pfarrer einem Kranken ein Buch von Wilhelm Busch mitgebracht habe, um ihn aufzuheitern. Nach einiger Zeit besuchte der Pfarrer den Kranken zum zweiten Mal und erkundigte sich auch danach, ob ihm das Buch gefallen habe. „Ja“, sagt der Mann, „sehr gut sogar, und wenn ich nicht gewusst hätte, dass es die Heilige Schrift gewesen ist, dann hätte ich manchmal laut lachen müssen…“
Vielleicht lachen wir in der Kirche nicht aus Tradition oder Ehrfurcht, das wäre immerhin noch nachzuvollziehen. Schlimmer wäre es jedoch, wenn unser religiöses Leben wirklich so aussähe: Wer mitten im Leben steht, wer Spaß und Freude am Leben hat, der möchte mit christlichen Vorstellungen wenig zu tun haben. „Christentum ist das, was man nicht darf“[1] denken viele Menschen.. Man könnte ergänzen: „Christentum ist das, was keinen Spaß macht, was langweilig ist.
Kirche wird oft mit Traurigkeit, Dunkelheit, Enge usw. in Verbindung gebracht. Aber haben Christinnen und Christen wirklich nichts zu lachen?
Ganz anders sieht es zumindest der Autor des folgenden Gedichtes:
„Ein Christ, der seinem Heil nachjagte,
auf Erden nie zu lachen wagte.
Es gälte, in den schweren Zeiten
sich mit viel Eifer zu bereiten
auf jenen Tag des Endgerichts;
zu lachen gäbe es da nichts.
Ach, dass so viele doch vergaßen,
dass denen, die im Finstern saßen,
ein helles Freudenlicht erschienen!
Sie hätten nicht mit sauren Mienen
die Frohe Botschaft umgebracht,
und das tut jeder, der nicht lacht.
Ein Christ hat wirklich alle Gründe
zu lachen – tut er‘s nicht, ist’s Sünde.
Humor sei, wenn man trotzdem lache,
dann ist er ja der Christen Sache.
Hätt‘ unsere Meister nicht Humor,
wir kämen längst schon nicht mehr vor.“[2]
„Ein Christ hat wirklich alle Gründe, zu lachen.“ Also gibt unser christlicher Alltag in diesem Punkt einen ganz falschen Eindruck wieder? Und wenn das stimmt: Was sind es für Gründe, aus denen heraus Christen „gut lachen“ haben?
Das Lachen der Christenheit ist ein Widerhall des Osterlachens. Das vielfache „Halleluja“ der Osternacht erscheint abgekürzt im Hahahaha des Alltags…
Weil wir geprägt sind von Hoffnung und Zuversicht in Bezug auf die letzten Dinge des Lebens, müssen wir die vorletzten Dinge und uns selber nicht zu ernst nehmen.
In der Dunkelheit der Welt scheint für uns die Osterkerze. Selbst in Verzweiflung und Not schimmert die Hoffnung durch auf eine Zukunft bei und mit Gott .
Der Apostel Paulus schreibt dazu:
Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden, und durch sie werdet ihr gerettet, vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von der Botschaft abbringen, die ich euch verkündet habe. Zu dieser Botschaft gehören folgende entscheidenden Punkte: Christus ist – in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift – für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben, und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der zwölf Jünger.
„Christus ist für unsere Schuld gestorben und am dritten Tag auferstanden von den Toten.“ Das ist der oberste und wichtigste Grund aller christlichen Freude, die Begründung für das Osterlachen. Darum ist Ostern das älteste und wichtigste Fest der Christenheit. Und weil es so zentral und wichtig ist, ist jeder Sonntag ein kleines Osterfest und der Sonntag zum ersten Tag der Woche geworden.
Ostern bedeutet: Der Tod ist überwunden! Gott ist in Christus Sieger geblieben und nicht am Kreuz gescheitert. Und weil es mit seinem Tod nicht ein-für-alle-Mal aus war, deshalb ist uns die Hoffnung eingepflanzt, dass die Sache Jesu weitergeht, dass auch wir persönlich eine Zukunft bei Gott vor uns haben.
Die Liturgie und die Gottesdienste spiegeln die Osterfreude ein Stück weit wider. Die Osternacht ist die große Wende:
– Thema „Freude“ statt „Trauer“;
– Feiern statt Fasten;
– Halleluja statt schweigen;
– aufrechtes statt knienden Gebets;
– Abendmahlsgemeinschaft mit dem Auferstandenen statt nur Erinnerung an sein Leiden und Sterben…
Heute haben oft nur noch die Kinder Freude am Osterfest. Dichter und Komponisten früherer Tage wussten eher etwas von der Osterfreude zu vermitteln:
„Die Welt ist mir ein Lachen mit ihrem großen Zorn.
Sie zürnt und kann nichts machen, all Arbeit ist verlor’n.“ (Paul Gerhardt, 1647)
„Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit.“ (15. Jahrhundert)
Ostern ist nun schon zwei Wochen vorbei, aber müsste die Osterfreude und das Osterlachen nicht weiter gehen? Nicht, dass Probleme übersehen oder verdrängt werden sollen, aber wären nicht ein wenig Glaubensgelassenheit und Glaubensheiterkeit angesagt, auch über den Ostertag hinaus, ja über unser zeitliches Ende hinaus?
Ich gehe gerne auf Friedhöfe, denn oftmals sind die alles andere als traurig, sondern Zeichen der Hoffnung, wobei diese Hoffnung zugegebenermaßen durch alte Grabsteine sehr viel deutlicher zum Ausdruck gebracht werden als durch moderne. Besonders schaue ich mir gerne die hier im Norden sehr verbreiteten Gesichter von Engeln auf den Grabsteinen an. Nicht selten haben sie ein fröhliches, lächelndes, verschmitztes Aussehen. Ein solches Engelsgesicht über dem Grabsteinspruch, dass der Verstorben „hier ruhe bis zur fröhlichen Auferstehung…“ sind tröstlich Worte in der österlichen Freudenzeit – und weit darüber hinaus!
Amen.
[1] Ernst Lange, Die zehn großen Freiheiten, 16. Auflage 1984, S. 5
[2] In: Ein Christ bekommt es mit der Welt zu tun, S. 47
Quasimodogeniti 2024
Text: Johannes 20, 19 – 29 i. A.
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn man einen Menschen kennt, der einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester hat, fragt man sich nicht selten, ob der andere Zwilling vielleicht genau so nett oder genauso unsympathisch ist wie der, den man kennt…
In der Bibel gibt es einen Jünger, der den Beinamen „Zwilling“ trägt, nämlich Thomas. Wir kennen ihn im Allgemeinen unter dem Namen „der ungläubige Thomas“. Das aber war er eigentlich gar nicht. Die Volksfrömmigkeit hat Thomas sogar so nahe an Jesus herangerückt, dass er als dessen Zwillingsbruder angesehen wurde. Das ist sehr unwahrscheinlich, aber merkwürdig ist es schon, dass der andere Zwilling nie ausdrücklich erwähnt wird. War Thomas also ein Zwilling ohne Zwilling? Vielleicht lernen wir diesen Zwilling ja in den nächsten Minuten kennen…
Im Johannes-Evangelium ist mehrmals von Thomas die Rede. Zum ersten Mal begegnen wir ihm im Zusammenhang mit der Auferweckung des Lazarus. Als Jesus die Nachricht vom Tod des Lazarus erhalten hatte, sagte er zu seinen Jüngern: „Lasst uns zu ihm gehen.“ Jesus meint damit: Lasst uns gehen, um einen Trauerbesuch zu machen und seinen Schwestern beizustehen. Thomas aber verstand die Aufforderung Jesu, zu Lazarus zu gehen, als Aufforderung mit ihm, Jesus, den Weg in den Tod zu gehen. Thomas ist dazu erstaunlicherweise sofort bereit. Er hält Jesus nicht von diesem Weg ab, wie es Petrus später tat, der dafür von Jesus als „Satan“ bezeichnet wurde. Vielmehr fordert Thomas die anderen Jünger dazu auf, zusammen mit Jesus zu sterben:
„Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm sterben!“ (Joh 11, 16)
Den Gedanken, dass die Jünger an seinem Schicksal beteiligt sein würden, hatte Jesus selber einmal geäußert. Thomas hatte das behalten und war bereit, bis zur letzten Konsequenz mit Jesus zu gehen. Das ist ein Charakterzug, der zu einem Zweifler kaum passt. Allerdings fehlte Thomas zu diesem Zeitpunkt noch das rechte Verständnis des Weges Jesu. Der weiß, dass Thomas noch eine lange Zeit brauchen wird, um alles zu begreifen.
Johannes stellt uns mit Thomas einen Menschen vor, in den wir uns gut hineinversetzen können, an dem wir Züge entdecken können, die wir auch bei uns selber entdecken können. Manche Ausleger meinen, Johannes stelle uns Thomas als „unseren eigenen Zwilling“ vor, als jemanden, der uns mit seinen Fragen und Zweifeln ganz nahe sei. Thomas: Bin ich das, sind Sie das, sind das nicht alle, die diese Geschichte hören?
Zum zweiten Mal begegnen wir Thomas als Sprecher der Jünger. Das ist ungewöhnlich, denn meist fiel diese Rolle Petrus zu. Jesus hatte mit seinen Jüngern über den Weg des Glaubens gesprochen und ihnen gesagt:
„Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen, und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Später werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja.“
Manchmal sitzt man in einer Veranstaltung und keiner traut sich, nach dem Referat etwas zu sagen. Es ist dann wie eine Erlösung, wenn sich endlich doch einer traut, eine Frage zu stellen oder einen Einwand zu erheben. So kommt mir Thomas vor: Er wagt es, auszusprechen, was vermutlich alle denken. Dazu gehört Mut. Er sagt:
„Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst! Wie sollen wir dann den Weg kennen?“ Und Jesus antwortet: „Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht.“
Wir brauchen auch heute Menschen, die wie „unser Zwilling“ Thomas den Mund aufmachen, die Fragen stellen, auch solche nach dem Glauben, damit wir sie miteinander und am Wort Gottes orientiert beantworten können.
Hätte Thomas das Ziel des Glaubens und den Weg dorthin nicht schon kennen müssen? Ich glaube das nicht, denn interessanterweise spricht er im Plural: „Wir wissen nicht, wo du hingehst.“ und keiner widerspricht ihm oder tadelt ihn, auch Jesus nicht, weil er Fragende nie tadelt oder abweist, damals nicht und heute nicht. Vielmehr macht er noch einmal deutlich: Der Zweifelnde und Suchende kommt zu Gott allein durch ihn, Christus: „Keiner kommt zum Vater denn durch mich!“
Die dritte Stelle im Johannes-Evangelium ist die bekannteste:
Am Abend des Ostertages waren die Jünger beisammen und hatten aus Angst die Türen abgeschlossen. Da trat Jesus in ihre Mitte und sagte: „Friede sei mit euch!“
Als die Jünger den Herrn sahen, überkam sie eine große Freude. Jesus sagte zu ihnen: „Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch! Wenn ihr jemand die Vergebung zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen.“
Als das passierte, war Thomas nicht dabei. Die anderen Jünger erzählten ihm später davon: „Stell Dir vor, wir haben den Herrn gesehen!“ Thomas antwortete ihnen: „Das werde ich niemals glauben! Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen – sonst nicht!“
Zehn ängstliche Jünger sitzen hinter verschlossenen Türen. Ihnen begegnet der Auferstandene, nur Thomas ist an diesem Abend nicht dabei. Wo er wohl war?
Ein Kollege berichtet, in einem Bibelkreis habe eine Frau darauf geantwortet: „Thomas war bestimmt einkaufen! Einer musste ja für die Truppe sorgen!“ Diese Frau hatte selbst immer viel zu tun damit, andere zu versorgen und zu entlasten. Für sich und ihre religiösen Fragen gönnte sie sich gar keine Zeit. Eine andere Frau antwortete: „Thomas war doch voll Trauer, er wollte sicher allein sein.“ Ob die eigene Trauer sie oft schon davon abgehalten hatte, zu glauben? Und ein immer etwas ängstlich wirkender Mann meinte, Thomas habe sich wohl aus Furcht irgendwo versteckt…
Es lohnt sich, sich in Thomas hineinzuversetzen, in unseren „Zwillingsbruder“, in dem wir vielleicht auch unsere Glaubenshindernisse wiederentdecken.
Thomas reagiert kühl auf die Erzählung der Anderen. Vielleicht wäre es jedem anderen Jünger auch so ergangen, wenn er zufällig nicht anwesend gewesen wäre. Thomas kommt allein jedenfalls nicht aus seinen Zweifeln heraus, er braucht Hilfe. Er ist uns auch darin sehr nahe. Und gerade diesen Zweifelnden nimmt Jesus so ernst, dass er für ihn ein zweites Mal in den Kreis der Jünger kommt!
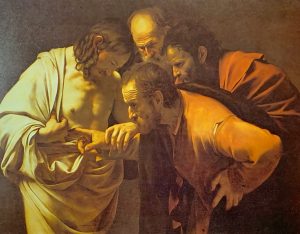
Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und diesmal war Thomas bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Plötzlich trat Jesus in ihre Mitte und sagte: „Friede sei mit euch!“ Dann wandte er sich an Thomas: „Leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an! Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seitenwunde! Hör auf zu zweifeln und glaube!“ Da antwortete Thomas: „Mein Herr und mein Gott!“
Thomas will dem Gekreuzigten begegnen, seine Wunden sehen und berühren, aber stattdessen begegnet er dem Auferstandenen. Durch die Begegnung mit dem Auferstandenen entsteht Glauben, damals wie heute. Thomas ist so überwältigt, dass das Betasten der Wunden ganz unwichtig wird. Er ist überwältigt und stammelt: „Mein Herr und mein Gott!“
Wie Thomas sollten wir Zweifel und Fragen nicht aus lauter Angst in uns hineinfressen. Sie dürfen dasein und ausgesprochen werden.
Thomas glaubt nun, und Jesus fährt fort:
Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben!
Was wir sehen, ist nur vordergründig. Gottes Wirklichkeit ist jedoch nicht mit unseren Augen erkennbar.
In der Antwort Jesu an Thomas steckt nicht weniger als eine Seligpreisung. Damit werden alle seliggesprochen, die an Gott glauben, obwohl sie ihn nicht sehen.
Im 21. Kapitel begegnet uns Thomas zum letzten Mal. Dieses Kapitel wurde zwar später an das Johannes-Evangelium angehängt, aber es ist ein Zeugnis dafür, dass Thomas nach der Begegnung mit dem Auferstandenen eine besondere Bedeutung in der Gemeinde hatte.
Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger…
In der Reihe der sieben Jünger, die dort erwähnt werden, steht Thomas an zweiter Stelle, direkt hinter Petrus, so wichtig war er anscheinend für die junge Gemeinde geworden! Wie schön, wenn Thomas auch in dieser Beziehung für viele von uns zum „Zwillingsbruder“ werden würde!
Amen.
Ostern 2024
Osterpredigt von Präses Dr. Thorsten Latzel
Joh 20,11-18
am Sonntag, 31. März 2024, 10 Uhr, Johanneskirche, Düsseldorf
Der Friede Gottes und die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Ostern, liebe Gemeinde, Ostern – da geht es um die großen Fragen: ob der Lauf der Welt sich ändern kann, ob wir uns ändern können, ob mit dem Tod alles aus ist, das Leben und auch die Liebe. Oder ob es Hoffnung gibt gegen alles Unrecht und alle Gewalt. Ostern geht es um die großen Fragen – und um die Hoffnung auf Gott, darauf, dass es anders wird, dass wir mit unserem ganzen menschlichen Schlamassel nicht alleine sind und bleiben, dass es gut wird. Ostern geht es um die großen Fragen
– und um das Schicksal dieses einen Menschen Jesus von Nazareth.
Die Antwort auf diese Fragen lässt sich nicht neutral beschreiben. Sie lässt sich nur erfahren und erzählen. Weil es um tiefe, letzte Lebenswahrheiten geht. Letztlich um Liebe.
Und Liebeswahrheiten lassen sich nicht beweisen, sondern nur erfahren und erzählen. Unter den Evangelisten ist Johannes wohl der größte Ostererzähler. Er erzählt in den Ostergeschichten von Menschen, die all ihren Glauben, ihr Lieben, ihr Hoffen verloren haben. Von Menschen, die sich innerlich tot fühlen. In deren Leben nur Leere ist, ein tiefes Loch. Von dem selbstsicheren Petrus, dem Felsenmann, der eine unaussprechliche, lähmende Schuld mit sich
herumträgt. Von dem Zweifler Thomas, der gerne glauben würde, aber nicht kann, wenn er nicht handfeste Beweise hat, den Finger nicht in die Wunde legen kann. Von Maria von Magdala, ihrer Liebe und ihrer Trauer. Von ihnen erzählt Johannes, von Schuld, Zweifeln und Trauer, von ihrem Unvermögen zu glauben, und wie es ihnen dennoch geschieht.
Wenn Sie auch solche Gefühle kennen, dass Ihnen die Welt, das Leben, Sie selbst manchmal entgleiten, wenn Sie gerne glauben würden, aber nicht können, wenn Sie manchmal diese große, tiefe Leere in sich spüren, wenn Ihre Hoffnung erstorben ist – oder kurz davor, dann gibt es vielleicht keine heilsamere Lektüre als die Ostergeschichten aus den letzten Kapiteln des Johannesevangeliums.
Es sind Erzählungen, in denen Menschen sehen, nichts begreifen und der Auferstandene sie dennoch wunderbar zurück ins Leben führt. Und wenn Sie ganz andere Gefühle haben und vor lauter Glück, Frühling, Liebe, Blütenzauber nicht wissen, wohin – Gott sei‘s gedankt! –, dann genießen Sie einfach die wunderschöne Liebesgeschichte von Maria von Magdala, der ersten Zeugin des Auferstandenen.
Zunächst die Vorgeschichte. Was bisher geschah. Maria von Magdala war eine Jüngerin, sie ist Jesus gefolgt, hat ihn unterstützt. Wie weitere Frauen, von denen oft nur am Rande die Rede ist. Doch die Beziehung zu ihr war noch einmal anders, besonders. Sieben Dämonen, so wird erzählt, hat er von ihr ausgetrieben. Bis zuletzt blieb sie bei ihm, bis unters Kreuz, als nur noch ein paar Frauen da waren und seine Jünger bis auf einen längst schon abgehauen. War Liebe dabei im Spiel? Sicher. Doch anders als in Romanzen. Es war die Liebe zu dem Menschen, der Gottes Liebe radikal gelebt hat, in dem Gott selbst unmittelbar gegenwärtig war.
Frühmorgens geht sie zum Grab, als es noch finster ist. Umgetrieben von der Liebe, die den Verlorenen sucht, ihrer Trauer, die sie nicht schlafen lässt, die sie hinaustreibt und alle, auf die sie treffen wird, nach ihm fragen lässt. So, wie wir es eben im Hohen Lied gehört haben.
„Ich suchte, aber ich fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen: »Habt ihr nicht gesehen, den meine Seele liebt?«
Sie sucht den Verstorbenen, doch was sie findet, ist das geöffnete Grab. Erschrocken erzählt sie es Petrus und dem Jünger, den Jesus liebhatte. Von ihm ist nur in den Passions- und Ostergeschichten des Johannes die Rede. Vermutlich ist der gleichnamige Jünger gemeint, dem auch das Evangelium zugeschrieben ist.
Der Erzähler also selbst ein Liebender. Petrus und dieser geliebte Jünger rennen sofort hin zum Grab. Der erste Osterspaziergang ist ein Wettrennen. Jungs eben. Wer ist als Erster da?
Wer geht als Erster rein? Wer glaubt als Erster? Doch letztlich bleibt all das oberflächlich, vorläufig im wahrsten Sinn des Wortes. Es kratzt nur am Rande des Wunders. Beide sehen das Grab und kehren wieder heim. Das hängt mit dem leeren Grab zusammen.
Ist das leere Grab notwendig für die Auferstehung? Nein. Sonst hätten wir ein Problem mit der Auferstehung aller anderen Verstorbenen davor und danach, deren Leichname sich allmählich auflösen. Gott ist frei, Leben zu schaffen, wie und woraus er will. Ist das leere Grab hinreichend für die Auferstehung, ein Beweis? Nein. Denn es ließe sich auch anders deuten. Auch das findet sich in der Bibel: Der Gärtner hätte den Leichnam verlegt, seine Anhänger ihn geraubt.
Das leere Grab ist ein kommunikativer Störer, eine heilsame Irritation. Für sich allein kratzt es nur an der Oberfläche: noch kurz ein Selfie vor der Grabkammer, dann geht es zurück. Das leere Grab hat damals wie heute nicht zum Glauben geführt. Es führt zu Erschrecken und Irritationen. Um dem Auferstandenen zu begegnen, braucht es etwas anderes.
Da beginnt nun unsere Geschichte. Und die Liebe kommt ins Spiel. Maria steht also allein vor dem Grab. Und sie weint. Gleich viermal wird dies in der kurzen Geschichte erzählt. Die beiden Jünger sind längst wieder verschwunden. Nur sie steht da und weint und kann nicht loslassen.
Es ist Liebessprache, in der ihre Trauer beschrieben wird.
„Als sie nun weint, beugt sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte.
Und die sprechen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“
Sie sieht als Einzige die Engel dort sitzen. Spricht mit ihnen. Doch das Überraschende: Es löst nichts aus. Anders als bei den anderen Ostergeschichten gibt es bei Maria nicht einmal ein Entsetzen. Nichts. Sie wendet sich einfach ab. Nicht nur das leere Grab, auch die Engel führen nicht zum Glauben. Weil es hier um ein Wunder, eine Wahrheit geht, die letztlich nicht einmal Engel vermitteln können. Maria wendet sich ab – und Jesus zu. Doch vor lauter Trauer erkennt
sie ihn nicht. Hält ihn, den sie sucht, für den Gärtner. Was für eine schöne Verwechslung! Der erste Osterwitz. Am Ende ist es immer der Gärtner.
Und noch einmal, wie im Traum, wiederholt sich das Gespräch. Bis hierhin verläuft noch alles weithin normal. Trauer, Verlust. Ein leeres Grab. Zwei Engel, o.k. Eine fremde Person. Nichts von Auferstehung. Doch nun passiert es.
Das Wunder, die Begegnung mit dem Auferstanden. Wie so oft kommt das Wunder in kleinen Schritten.
„Spricht Jesus zu ihr: Maria!“
Jesus ruft sie bei ihrem Namen. Der, den sie sucht, findet sie. Er nennt sie und erkennt sie, so wie sie sich nicht einmal selbst kennt.
„Maria!“
Da liegt alles drin. Die sieben Dämonen. Ihr Leben, ihre Liebe, ihre Trauer. Wer sie war, wer sie ist.
„Maria!“
Call me by my name. Die tiefe Sehnsucht, dass es einen gibt, der mich besser kennt als ich mich selbst, der mich liebt und versteht und mich bei meinen Namen ruft.
„Maria!“
„Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch:
Rabbuni!, das heißt: Meister!“
Diese kleine Stelle hat den Auslegern großes Kopfzerbrechen bereitet. Wie kann Maria, die sich Jesus schon zugewandt hatte und längst mit ihm spricht, sich ihm noch einmal zuwenden?
Das Wunder von Ostern hängt mit diesem kleinen Detail zusammen: dem Geheimnis der zweiten Wendung.
„Da wandte sie sich um …“
Beim ersten Mal wendet sich Maria vom leeren Grab zum Gärtner. Sie kehrt ihren Körper um, physisch, doch ihre Seele bleibt starr. Beim zweiten Mal wendet sie sich zu dem, der sich ihr zugewandt hat. Zu dem, der sie bei ihrem
Namen ruft. Der sie tiefen-kennt, den sie liebt, der also nicht mehr tot sein kann. Zum Auferstandenen. Wie die Blume sich zur Sonne kehrt. Seelen -Wende.
Und sie spricht zu ihm in der Sprache, die sie immer gesprochen haben. Und nennt ihn, wie sie ihn immer angesprochen hat: Rabbuni. Meister.
Die zweite Wende ist die Kehre vom Tod zum Leben, der Moment, in dem Maria selber aufersteht. Der Tod hat für sie keine Macht mehr.
„Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an!“
Das ist der am häufigsten zitierte Satz der Geschichte und zugleich der schwierigste: „Noli me tangere“ – Rühre mich nicht an.
Da begegnet Maria also – endlich – dem auferstandenen Jesus. Und sogleich entzieht er sich ihr wieder. Derselbe Auferstandene wird bald darauf dem zweifelnden Thomas begegnen und ihn auffordern: „Lege deine Hand in meine Seite, deine Finger in meine Wunde.“ Was meint dann also das „Rühre mich nicht an“? Andere haben die ursprünglich griechischen Worte übersetzt als: „Halt mich nicht fest! Halt mich nicht auf!“ Der Auferstandene ist ganz gegenwärtig und zugleich völlig entzogen. Das erfährt Maria wie alle, die ihm begegnen. Die Liebe, die den Tod besiegt hat, ist nicht beweisbar, handhabbar. Sie lässt sich nur erfahren und erzählen. Und das tut Maria.
„Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: »Ich habe den Herrn gesehen«, und was er zu ihr gesagt habe.“
Dies war der Anfang des unsterblichen Gerüchts vom Wunder der Auferstehung Christi und dem Sieg der Liebe Gottes über den Tod. Doch was heißt das nun für Sie, für mich: für die tiefe Leere in mir, für meine Hoffnung, die erstirbt, für meine Unfähigkeit zu glauben?
Ja, an die Auferstehung zu glauben ist eine menschliche Unmöglichkeit. Wir kommen nicht weiter als bis zum leeren Grab, wir kratzen nur wie die Jünger an der Oberfläche. Ich finde Christus, das Leben, die Liebe nicht. So sehr ich mich bemühe. Doch Christus, der Auferstandene, findet mich. Er erkennt mich – tiefer, als ich es selbst jemals vermag – mit den Augen der Liebe Gottes. Und ruft mich bei meinem Namen: „Thorsten! Sarah! Michael! Johanna! Maria!“ Call me by my name. Und dann ist es an mir, die zweite Wende zu tun: meine Seele dem Licht der Liebe Gottes zu öffnen. Loslassen – meine alten Bilder von mir, anderen, dem Leben, von Gott.
„Halte mich nicht fest!“ Und auferstehen. Selber auferstehen. Indem ich aus dieser unverfügbaren Hoffnung lebe, dass Gottes Liebe stärker ist als der Tod. Wider alle Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Eine Liebeswahrheit, die sich nicht beweisen lässt, sondern nur erfahren – und erzählen.
„Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“
Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.
Amen.
Gründonnerstag 2024
Text: Lukas 22, 7 – 23
Liebe Leserinnen und Leser,
Der alte Vater musste plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach den ersten Untersuchungen ergab sich, dass eine schwere Operation nicht zu umgehen war. Vorher durfte er das Krankenhaus aber noch einmal verlassen und einen Sonntag im Kreis seiner Familie verbringen.
Die Mutter hatte es sich nicht nehmen lassen, einen Apfelkuchen zu backen. Die erwachsenen Kinder kamen zum Nachmittagskaffee und saßen um den festlich gedeckten Tisch. Der Vater nahm seinen Platz am Ende des Tisches ein. Sein Blick verweilte lange auf dem bunten Herbstwald gegenüber. „Wie schön wir es doch haben!“ sagte er dankbar.
Die Stimmung der Familie war heiter, obwohl allen das Risiko der Operation bewusst war. Man erzählte von den Enkeln, von Familienfesten, Erinnerungen wurden ausgetauscht. Man nutzte die begrenzte Zeit, denn am Abend musste der Vater ins Krankenhaus zurück.
Auf einmal stand der jüngste Sohn auf und kam mit einem Geschenkkarton wieder. „Ich wollte dir das eigentlich erst zum Geburtstag geben, aber vielleicht freut es dich heute schon.“ Ahnte er, dass der Vater den Geburtstag nicht mehr erleben würde?
Der Vater packte ein fein geschliffenes, altes Trinkglas aus und hielt es gegen das Licht. Er hatte einen Blick für gutes Glas, denn seine Vorfahren waren seit Generationen Glasmacher gewesen.
Alle Anwesenden nahmen an der großen Freude und Rührung des Vaters teil. „Hört nur, was hier eingraviert ist“, rief er und las feierlich: „Zur Gesundheit des Königs!“
Man freute sich, wertete das Geschenk als ein gutes Zeichen, machte dem Vater Mut. Er hörte sich alles schweigend an und sagte schließlich: „Sollte ich nicht zurückkommen, nehmt das Glas als Erinnerung an mich und an diesen schönen Nachmittag.“
Wenig später musste der Vater gehen. Sein Haus hat er nicht mehr betreten…
Eine Geschichte der Kinderbuchautorin Mechthild Theiss. Im Mittelpunkt steht eine besondere Mahlzeit, die unvergesslich wurde für alle Beteiligten, weil es die letzte Mahlzeit mit dem kranken Vater war. Unvergesslich war der Tag, weil ein Symbol, das wertvolle Glas, eine Rolle darin spielte, und weil es Worte des Vaters über seinen Tod hinaus gab.
Eine Geschichte begegnet uns, die zugleich traurig, aber irgendwie auch friedlich und harmonisch ist.
Die Geschichte erinnert mich stark an den heutigen Predigttext. Auch darin geht es um eine letzte Mahlzeit, um einen Abschied, um Trauer und Hoffnung und um ein ganz besonderes Symbol. Der Text steht im 22. Kapitel des Lukasevangeliums. Jesus war zuvor mit seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen, um dort das Passafest zu feiern, an dem sich das jüdische Volk an die Befreiung aus Ägypten erinnerte. Dann heißt es:
Es kam der erste Tag des Festes, der Tag, der für das Schlachten des Passalamms bestimmt war. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt. „Geht voraus und bereitet das Passamahl für uns vor!“ „Wo sollen wir es vorbereiten?“ „Wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er geht, und sagt zu dem Hausherrn: ‚Der Meister lässt dich fragen, wo der Raum sei, in dem er mit seinen Jüngern das Passamahl feiern könne.‘ Er wird euch ein großes Zimmer zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Bereitet dort das Mahl vor.“
Die beiden Jünger machten sich auf den Weg. Sie fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passamahl vor. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln an den Tisch und sagte: „Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Ich werde es nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt.“ Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür, sprach das Dankgebet und sagte: „Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus und teilt ihn unter euch. Von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist.“ Dann nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: „Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern!“ Nachdem sie gegessen hatten, nahm er einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: „Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch der, der mich verrät, sitzt hier mit am Tisch. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihm bestimmt ist; aber wehe dem Menschen, der ihn verraten wird!“ Da fingen die Jünger an, einander zu fragen, wer von ihnen es wohl sei, der so etwas tun werde.
Wie schon angedeutet, ist diesen beiden Geschichten vieles gemeinsam. Aber es gibt auch wesentliche Unterschiede, wodurch die Einmaligkeit des letzten Abendmahls deutlich wird:
Das Abendmahl ist nicht das Ende.
Der Vater in unserer „Familiengeschichte“ kommt nach dem denkwürdigen Nachmittag nicht wieder nach Hause. Die letzte Mahlzeit mit ihm werden die Seinen nie vergessen. Dieses Erlebnis war für die Angehörigen wertvoll und kostbar, aber es änderte nichts am baldigen Tod des Vaters.
Die Sache Jesu war dagegen mit dem letzten Abendmahl nicht zu Ende, sie ging vielmehr weiter. Sie führte zwar mit dem Karfreitagsgeschehen zunächst auch in den Tod, dann aber schon auf Ostern zu, auf die Auferstehung, auf ein Leben, dem selbst der Tod nichts anhaben konnte. Die Sache Jesu geht weiter: Ostern als Grund unserer Hoffnung, Pfingsten als das Versprechen von Gottes Zuspruch und Tröstung auf all unseren Wegen, seine Begleitung in Gegenwart und Zukunft. Darum ist das Abendmahl mehr als ein reines Erinnerungsmahl: Es gibt uns Kraft und Zuversicht über den Tod hinaus, es hat Auswirkungen auf unser Heute und unser Morgen.
Jesus ist der Gebende und Handelnde.
Der Vater in unserer Geschichte wird beschenkt. Es ist eine schöne Geste des Sohnes. Der Vater aber muss sein Leben nun in die Hände von Pflegekräften und Ärzten legen. Jesus dagegen ist der Gebende, der Schenkende. Im Evangelium des heutigen Sonntags haben wir gehört, wie Jesus sogar den Jüngern die Füße gewaschen hat. Auch hier beim Abendmahl handelt Jesus: Er gibt seinen Jüngern Brot und Wein, schenkt sich ihnen und uns in der Gestalt dieser beiden Elemente.
So ist es auch in jedem Gottesdienst: Nicht wir erweisen Gott einen Dienst damit, dass wir in die Kirche gehen, sondern Gott dient uns, indem er uns sein Wort und seine Gegenwart schenkt, und indem er uns unsere Schuld vergibt und immer wieder einen neuen Anfang ermöglicht.

Alle dürfen mit am Tisch des Herrn sitzen.
Am Tisch des alten Vaters sitzt seine engste Familie, Menschen, die ihm nahe stehen, die ihm seelischen Beistand geben wollen. An Jesu Tisch sitzen dagegen ganz unterschiedliche Menschen. Einige von ihnen kennen wir:
Da ist Petrus, der wenige Stunden später Jesus verleugnet, indem er heftig bestreitet, ihn zu kennen. Und mit dem will Jesus seine Kirche bauen…
Und dann ist da Thomas, der zweifelt. Dieser Thomas ist Jesu so wichtig, dass er um seinetwillen nach seiner Auferstehung zum zweiten Mal zu den Jüngern kommt. Wer nachdenkt und zweifelt gehört fraglos in den Kreis der Gläubigen, denn nur die Ungläubigen kennen keinen Zweifel.
Und dann sitzt da zunächst auch noch Judas mit am Tisch. Viele Ausleger gehen heute davon aus, dass er ein glühender Anhänger Jesu war und seinen Meister nicht wegen eines geringen Geldbetrags verraten hat. Vielmehr wird angenommen, dass er durch seinen vermeintlichen Verrat Jesus dazu bringen wollte, endlich loszuschlagen und das Reich Gottes mit Gewalt zu errichten. Das war ein gravierendes Missverständnis. Aber ich bin sicher, auch ihm hätte Jesus vergeben, wäre er in seiner Verzweiflung zu ihm zurückgekommen, denn keiner wird vom Tisch Jesu ausgeschlossen, außer demjenigen, der sich selber ausschließt.
Amen.
Judika 2024
Text: Genesis 22, 11 – 13
Liebe Leserinnen und Leser,
vor einigen Jahren war ich mit Kolleginnen und Kollegen auf einer Rüstzeit im Harz. Es ging darum, wie sehr man seine eigene Person in das gottesdienstliche Geschehen einbringen kann bzw. sollte, etwa wenn man biblische Texte vorzulesen hat. Ein Kollege, der kurz vor dem Ruhestand stand, hatte die Aufgabe, eine bestimmte Geschichte vorzulesen. Er tat das fehlerfrei, aber ohne allzu große Anteilnahme zu zeigen.
Der Leiter wollte ihm und uns jedoch die ganze Tiefe dieses Textes nahebringen. In vier Spielszenen musste der Vorleser abwechselnd in die verschiedenen Rollen der Geschichte hineinschlüpfen. Die Szenen wurden so realistisch wie möglich gespielt: Da wurde gekämpft, geschrien, gefleht und es fielen sehr drastische Worte. Das Ganze dauerte länger als eine Stunde. Dann wurde der Kollege gebeten, den Text nochmals vorzulesen. Er begann, musste aber schon nach wenigen Sätzen abbrechen, weil er seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte, so überwältigt war er jetzt von dem Text.
Dieser Text ist auch in meinen Augen der wohl schwerste und schwierigste aller Bibeltexte. Er steht im Ersten Buch Mose und ist für den heutigen Sonntag als Predigttext vorgesehen. Da er an manchen Stellen wirklich sehr verstörend ist, möchte ich nur den Schluss vorlesen und den Anfang lediglich kurz skizzieren:
Abraham hatte von Gott den Befehl erhalten, seinen einzigen Sohn als Beweis für seinen Glauben zu opfern. Tatsächlich machte er sich zusammen mit seinem nichts-ahnenden Sohn auf, die grausame Tat zu begehen. Als er gerade sein Messer ansetzen wollte, geschah Folgendes- und hier beginnt der Bibeltext:
Da rief der Engel des Herrn vom Himmel herab: „Abraham, hör auf! Tu dem Jungen nichts! Gott weiß nun, dass du Ehrfurcht vor ihm hast, denn du hättest für ihn nicht einmal deinen einzigen Sohn verschont!“ Abraham schaute sich um und entdeckte hinter sich einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hin, packte den Schafbock und brachte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer dar.
Am Anfang der Geschichte, wenn man sie im Original hört, geht es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so wie damals meinem Kollegen: Das ist, wenn man sich wirklich in diese Szene hineinversetzt, kaum auszuhalten. Man möchte Abraham am liebsten festhalten, um ihn von seinem wahnsinnigen Vorhaben abzubringen. Es darf nicht wahr sein, was der für den Willen Gottes hält!
Auch in mir wehrt sich vieles gegen diesen Text: Gott soll einem Vater den Befehl gegeben haben, sein einziges Kind grausam zu töten? Einen solchen Gott kann ich nicht lieb haben, er ist mir fremd, und er wirkt abstoßend auf mich.
Abraham aber wird für seinen Gehorsam ausdrücklich gelobt. Auch er wird mir damit fremd: Sein eigenes Kind freiwillig umzubringen, das passt einfach nicht in meine Vorstellung von Gott, das passt auch so gar nicht zu der liebenden Art Jesu. Dieser Befehl Gottes ist unmenschlich und unchristlich zugleich. Abraham wäre ein Fall für die Psychiatrie und müsste mit lebenslanger Sicherheitsverwahrung rechnen, wenn er heute im Auftrag Gottes sein Kind umbringen würde.
Eine jüdische Legende erzählt, dass Sarah bei der Nachricht von dem bevorstehenden grausamen Geschehen sechsmal aufgeschrieen habe – und dann verstorben sei: Sarah als diejenige, die Nähe, Liebe und Menschlichkeit besaß, Abraham dagegen als der, der fromm, gottesfürchtig und unmenschlich war?
Aber halten wir einen Augenblick in unserer Entrüstung inne. Ist es denn tatsächlich so, dass Abraham gelobt wird, weil er bereit ist, seinen Sohn zu opfern? Oder verstehen wir die Geschichte vielleicht grundlegend falsch, wenn wir es für den Willen Gottes halten, ein unschuldiges Kind zu opfern?
Vielleicht soll mit der Geschichte ja genau das Gegenteil ausgedrückt werden. Vielleicht lag ja die Versuchung für Abraham darin, dass er meinen könnte, mit einem Menschenopfer Gott einen Gefallen zu tun. Gott hätte Abraham dann durch das Geschehen deutlich machen wollen, dass er gerade das nicht will. Das ist durchaus möglich, denn die Geschichte hätte ja auch folgendermaßen enden können:

Gerade wollte Abraham seinen Sohn töten, da erschien ein Engel des Herrn und rief: „Abraham, hör auf! Tu dem Jungen nichts! Gott will dir heute deutlich machen, dass du ihm kein Menschenopfer bringen musst. Der Weg Gottes ist ein ganz anderer. Sieh, dort im Gebüsch hat sich ein Widder verfangen, den nimm und opfere ihn an Stelle deines Sohnes. Gott will nicht, dass jemals ein Mensch für ihn geopfert wird.“
Abraham war alles andere als erleichtert, als er diese Worte hörte, ganz im Gegenteil, er wurde schrecklich wütend. Die Zornesröte stieg ihm ins Gesicht und er schrie:
„Geh weg von mir, du Satan, und störe mich nicht bei meinem heiligen Auftrag, den ich von Gott selber empfangen habe. Du kannst gar kein Bote Gottes sein, denn du willst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich und verwerflich ist. Gott selber hat mir doch diesen Befehl gegeben, und ich werde ihn ausführen, was immer auch kommt. Der Gehorsam gegen Gott ist das Wichtigste in meinem Leben, da müssen die Familie und alle Gefühle hintenanstehen. Ich werde meinen Sohn opfern, weil es der eindeutige Wille Gottes ist.“
Und Abraham nahm das Messer, erhob es und wollte seinen Sohn niederstechen. Aber da fiel ihm der Engel des Herrn in den Arm, so dass er nicht zustechen konnte und sein Sohn nur leicht verwundet wurde. Der Engel forderte Abraham daraufhin mit deutlichen Worten auf, mit seinem Sohn zurück zu seiner Familie zu gehen. Abraham war sehr zerknirscht, nur unwillig folgte er dem Befehl des Engels, vor allem, weil der viele stärker war als er selbst.
Als er nach Hause kam, war die Freude der Familie groß. Nicht so bei Abraham. Er war immer noch voller Zweifel und haderte mit sich, dass er dem Befehl Gottes nicht gefolgt war.
Zum Glück hat Abraham so nicht gehandelt. Er hat auf das neue Gebot Gottes gehört. Und damit ist er nun plötzlich ganz nah bei Jesus Christus, der sagt: „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe.“ (Joh 13,34) Vielleicht hat Abraham schon etwas von diesem göttlichen Gebot geahnt, denn er sagt interessanterweise zu seinen Knechten, als er losgeht, um seinen Sohn zu opfern: „Wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen.“ Wir -wohlgemerkt: Plural – wir wollen zurückkommen, nicht: Ich will zurückkommen. Und man spürt bei ihm auch keine Spur von einem Widerstand gegen den Befehl des Engels, der ja immerhin den vermeintlichen Befehl Gottes aufhebt. Abraham muss etwas von Gottes Güte und Liebe gewusst oder zumindest geahnt haben.
Ich bin überzeugt, dass wir in Abraham keinem religiösen Betonkopf begegnen, sondern jemandem, der sich auf Gott einlässt und auf den sich daher auch Gott einlässt.
Das Sterben des Widders an Stelle von Isaak ist natürlich auch ein Hinweis auf die Passion, auf das Leiden, Jesu. Jesus ist für die Menschen gestorben, so wie der Widder für Isaak gestorben ist. In der Tat nennt die Christenheit Jesus ja das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Dieser Tod ist entscheidend für unser Leben, wohingegen sich jeder andere gewaltsame Tod gegen Gottes Willen richtet. Abraham hat das geahnt, wir dagegen dürfen es wissen mit Blick auf den, er für den Menschen starb und am dritten Tage auferstanden ist.
Amen.
Lätare 2024
Text: Johannes 6, 47-51
Liebe Leserinnen und Leser,
„Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt alle, die Ihr sie lieb habt.“ Der Anfang dieses lateinischen Satzes hat Pate gestanden für den Namen des heutigen Sonntags: Lätare, freut euch!
„Freut euch…“ in der Passionszeit, passt das überhaupt zusammen? Es passt, denn die Sonntage sind eigentlich aus der Passionszeit herausgenommen, weil jeder Sonntag so etwas wie ein kleines Osterfest ist, an dem man sich an die Auferstehung Jesu erinnern kann. Das gilt auch für die Sonntage in der Passionszeit, vielleicht so wie es in einem unserer Choräle heißt: „In dir ist Freude in allem Leide…“
Freuen dürfen wir uns trotz des Leides, an das wir in der Passionszeit denken, und trotz des Leides, das Menschen in aller Welt augenblicklich erleben. Freuen dürfen wir uns etwa über die „geistlichen Gaben“, die Gott uns schenkt. Im heutigen Predigttext geht es da um das „Brot“.
„Brot für die Welt“ ist eine der bekanntesten Aktionen der Evangelischen Kirche. Seit Jahrzehnten wird zu Spenden für not-leidende Menschen in aller Welt aufgerufen. Der Name der Aktion macht deutlich: Der Mensch braucht nicht nur das Wort Gottes, er braucht auch etwas für den Magen. Man kann Menschen, denen das Evangelium verkündet wird, nicht gleichzeitig verhungern, verelenden oder erfrieren lassen. Leib und Seele gehören zusammen.
Heute werden wir durch den Predigttext allerdings auf die andere Seite der Medaille aufmerksam gemacht: So falsch es wäre, wenn die Kirche sich nur um die Seele des Menschen und nicht auch um sein Wohlergehen kümmern würde, so falsch wäre es auch, wenn sie über der Sorge für das leibliche Wohl des Menschen seine Seele verkümmern ließe.

Für den Hunger der Seele hat die christliche Kirche eine Antwort. Jesus spricht in diesem Zusammenhang vom „Brot des Lebens“, das eine „Speise für unsere Seele“ sein könne. Aufgezeichnet sind die Worte Jesu im sechsten Kapitel des Johannes-Evangeliums:
Ich versichere euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens.
Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt: Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.
Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können.
1. Brot, das wirklich satt macht
Manchmal sagt meine Frau, wenn wir Brötchen essen: „Die machen ja gar nicht satt.“ Es gibt in der Tat große Unterschiede bei Brot und Brötchen. Manche haben noch sehr viele wichtige Inhaltsstoffe, sie machen satt. Andere bestehen fast nur aus dem weißen Mehlkörper, es steckt nicht mehr viel dahinter, man hat bald wieder Hunger.
So ist es wohl auch mit dem Glauben. Da gibt es sehr leichte Kost, die auf den ersten Blick, oder besser: Biss, angenehm schmeckt, wie das knusprige Brötchen am Morgen. Diese Kost gleicht einem Glauben, der allen alles recht machen will und der nicht viel mehr zu bieten hat, als die Parole, nett zueinander zu sein.
Jesus hat dagegen den Menschen keinen seichten und leichten Glauben versprochen, im Gegenteil. Über die Nachfolge hat er einmal gesagt: (Matthäus 8, 20)
„Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihr Nest; aber der Menschensohn hat keinen Platz, wo er sich hinlegen und ausruhen kann.“
Und bei anderer Gelegenheit heißt es bei ihm: (Lukas 9, 23)
„Wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen.“
Der Weg des Glaubens ist nicht immer ein Spaziergang. Aber da, wo ich mich auf den Glauben einlasse, wo ich mich auf Gott einlasse, werde ich nicht in einer Sackgasse landen, sondern das Ziel meines Lebens erreichen.
Jesus sagt: Das Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Leib.
Vermutlich denken wir dabei an die Worte bei der Einsetzung zum Heiligen Abendmahl: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird…“
Aber es geht wohl um mehr: Um ein sich Hineinversetzen in Jesus, um ein Einswerden mit ihm. Er liefert sich der Welt mit Haut und Haaren aus, aber nehmen wir ihn auch auf mit Haut und Haaren, identifizieren wir uns mit ihm? Werden wir eins mit ihm?
Das ist sicher nicht einfach, zu keiner Zeit, weder für die Jünger noch für die Alte Kirche und erst recht nicht heute, wo unsere Lebensverhältnisse so weit von den Idealen Jesu entfernt sind. Aber nichtsdestoweniger sind wir immer wieder aufgefordert, uns das Beispiel Jesu vor Augen zu halten, uns einzulassen mit ihm.
Manna gab es für das Volk Israel nur für kurze Zeit, die süße Pampe war nichts für alle Tage. Ein kräftiges Schwarz- oder Vollkornbrot ist ein viel besseres Lebensmittel. Das gilt ganz ähnlich in Bezug auf unsren Glauben.
2. Hoffnung, die sich nicht unterkriegen lässt
Das Bild vom Brot des Lebens, das Jesus hier gebraucht und das für immer satt mache, ist ein Hinweis auf ein unvergängliches Leben.
Davon sprechen unsere Glaubenszeugnissen, das predigen wir an den Gräbern unserer Lieben. Kann man die Hoffnung auf ein Leben bei Gott aus dem christlichen Glauben herauslösen ohne den Glauben damit grundsätzlich zu verändern?
Ich glaube nicht. Es gehört zu unserem Glauben dazu, dass wir in der Hoffnung leben, auch nach dem Tod aufgehoben zu sein bei Gott.
Was sollte man den Eltern des ertrunkenen achtjährigen Jungen denn sagen? Was der Ehefrau des 32Jährigen, der bei einem Autounfall stirbt? Was den Eltern, deren zweijähriges Kind morgens tot in seinem Bettchen liegt?
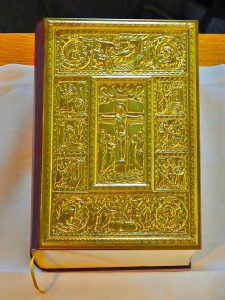
Nicht, dass die christliche Hoffnung den Hinterbliebenen ihren Schmerz und ihre Trauer nehmen würde. Aber dieser Glaube kann sie vor der Verzweiflung bewahren. Auch für unsere Lieben haben wir diese Hoffnung und feste Zuversicht: Sie sind aufgehoben bei Gott, wie immer man sich das in Einzelnen vorzustellen hat: Gott schenkt Leben, das uns niemand nehmen kann, Brot des Lebens, das satt macht für alle Zeiten.
Mit dieser Hoffnung lebe ich, mit dieser Hoffnung kann man getrost sterben. Und diese Hoffnung kann uns jemand nehmen.
„Meine Schläge“, gab das Schicksal in einem Interview zu, „sind hart, und meine Rechte ist ebenso gefürchtet wie meine Linke. Treue, Glaube, Liebe, kurz, auch die schwersten Brocken habe ich auf die Bretter geschickt, und sie wurden sämtlich ausgezählt. Nur mit einem habe ich bisher nicht fertig werden können. Sooft ich ihn auch k. o. schlage und davon überzeugt bin, dass er nun endgültig ausgezählt auf dem Boden liegen bleibt – spätestens bis ‚neun‘ ist er wieder auf den Beinen.“ „Und wer“, fragte der Interviewer, „ist dieser Unbezwingbare?“ „Die Hoffnung“, sagte das Schicksal.
Amen.
Okuli 2017
Text: Genesis 50, 15-22. 24
Liebe Leserinnen und Leser,
„Einem niederhessischen Landedelmanne, der seit langem krank war, träumte es in der Nacht…, seine Erlösung sei nahe. Er grübelte lange darüber nach, was unter der nahen Erlösung zu verstehen sei, und je nach seiner wechselnden Gemütsverfassung meinte er bald, es werde ihm sein bevorstehender Tod, und bald, es werde ihm seine Heilung angezeigt. Manchmal verschmolzen sich ihm auch diese beiden Möglichkeiten zu einem einzigen Gedankengebilde. An eine Heilung hatte er seit längerem keinen Glauben mehr, und wenn er sie mitunter dennoch für möglich gehalten hatte, so meinte er gleich danach, einem Selbstbetruge erlegen zu sein. Die Krankheit bestand in einer unförmigen, bald weicheren, bald härteren Geschwulst zwischen dem linken Hüftknochen und dem Brustkorb, aber sie war längst über ihren ursprünglichen Ort hinausgewuchert, sichtbarlich nach außen hin, aber, wie es schien und wie die Ärzte annahmen, auch nach innen, denn anders vermochte man sich furchtbaren Schmerzen, die Beklemmungen des Atems, die Schlaflosigkeit und die häufigen Fieberanfälle, denen er ausgesetzt war, nicht zu erklären…“
Mit diesen Worten beginnt die Erzählung „Der Arzt von Weißenhasel“ von Werner Bergengruen.
Der Edelmann träumt eines Nachts von seiner Heilung und lässt sich daraufhin in einer Kutsche Richtung Marburg zur medizinischen Fakultät fahren Durch einen weiteren Traum und durch eine junge Zigeunerin wird ihm unterwegs der Ort Weißenhasel vor Augen gestellt, wo er Heilung erfahren soll. Er findet schließlich diesen Ort, wird aber noch vor den Toren des Ortes überfallen, beraubt und niedergestochen. Durch diesen Angriff wird das Geschwür geöffnet und das ist der Beginn seiner Heilung: „In aller Schwäche fühlte er eine Erleichterung und Befreiung, die ihm Tränen in Kehle und Augen treiben wollten und ein neues Dasein verhießen.“ Dem Räuber vergibt er daher.
Eine Geschichte nur, und Gott kommt darin scheinbar gar nicht vor. Oder ist er doch still am Werk und wendet das Böse zum Guten?
Die Menschen des Alten Testamentes fühlten, dass man Gott nicht in Bildern oder Statuen oder feste Vorstellungen und Dogmen pressen konnte. Was aber über Gott zu wissen war, das fand sich in Geschichten darüber, was Menschen in bestimmten Situationen mit Gott erlebt hatten, wie Gott in schwierigen Zeiten für sie da war. Gott stellte sich ihnen vor mit dem frei übersetzten Namen „Ich bin für Euch da“.
War dieser Gott in Weißenhasel zugegen und hatte er die böse Tat zum Guten gewendet?
Eine der schönsten Erzählungen der Bibel ist für mich die Josephsgeschichte: Jakob, der Erz- Vater, hatte zwölf Söhne, und Josef war sein Liebling. Der hatte hochtrabende Träume, in denen er sich als wichtiger und bedeutender sah als seine Brüder und seine Eltern. Die Brüder haben sein Gehabe eines Tages satt und verkaufen ihn als Sklaven nach Ägypten. Dort bekommt er nach einiger Zeit eine wichtige Position im Hause eines Kämmerers, wird fälschlicherweise des Vergewaltigungsversuches bezichtigt, landet im Gefängnis und wird schließlich gerufen, um die Träume des Pharaos zu deuten. Die richtige Auslegung der Träume macht ihn zu einem mächtigen Mann in Ägypten. Er sorgt sich nun um die Menschen und trifft Vorsorge für eine bevorstehende Hungersnot. Als sie eintritt ist auch die alte Heimat betroffen und seine Brüder kommen ahnungslos nach Ägypten um Getreide zu kaufen. Josef gibt sich ihnen zu erkennen und versöhnt sich mit ihnen. Schließlich kommt auch Josefs Vater mit seiner ganzen Sippe nach Ägypten. Als er fast zwanzig Jahre später stirbt, geraten die Brüder in Panik. Hier beginnt der heutige Predigttext:
Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. „Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt!“, sagten sie zueinander. „Sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben.“ Sie ließen Josef daher ausrichten: „Dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben: ‚Bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt.‘ Deshalb bitten wir dich: Verzeih uns unser Unrecht! Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen!“
Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten: „Wir sind deine Sklaven!“ Aber Josef erwiderte: „Habt keine Angst! Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat! Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet; denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan, und so ist es geschehen. Habt also keine Angst! Ihr könnt euch auf mich verlassen, ich werde für euch und eure Familien sorgen.“
So beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut.
Die Brüder haben zu Lebzeiten des Vaters viel Gutes von Josef erfahren, nun aber fehlt ihnen das Vertrauen zu ihrem mächtigen Bruder. Menschlich gesehen ist die Angst verständlich, dass das Wort des Vaters nach seinem Tod für Josef keinen Bestand mehr haben könnte. Gering ist das Vertrauen nicht nur zu Josef, sondern auch zu seinem Glauben: Könnte er als Mann Gottes seine Brüder kaltblütig ermorden?
Für die Brüder Josefs ist auch die Schuldfrage noch nicht abgeschlossen, ihr Gewissen ist noch nicht zur Ruhe gekommen. Josef beruhigt sie, verzichtet nicht nur auf Rache, er bläst es auch nicht dabei, zu sagen, dass allein Gotte sich rächen könnte. Im Gegenteil: Gott selber hat Böses zum Guten gewendet.
Darum geht es in unserem Predigttext, dass aus einer bösen Absicht mit Gottes Hilfe etwas Gutes entstehen kann. Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu („Widerstand und Ergebung“):
„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.“
Gott kann das Böseste zum Guten wenden, aber dazu will er Menschen gebrauchen, die in seinem Namen für das Gute eintreten. Wenn das passiert, kann der Straffällige in der Justizvollzugsanstalt erfolgreich eine Lehre machen, der Alkoholiker durch den Besuch beim Blauen Kreuz zum Glauben kommen oder der Schwerkranke zur Ruhe und zum Nachdenken über sein Leben kommen und neue Prioritäten setzen.
Sind solche Beispiele Geschichten, die das Leben schrieb, oder Geschichten mit Gott? Wir sollten jedenfalls bereit sein für die Geschichten, die Gott mit uns schreiben will, und vor allem bereit sein, darin eine aktive Rolle zu übernehmen. „In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott… auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.“ (Bonhoeffer)
In der Passionszeit werden wir erinnert an das Leiden und Sterben Jesu, das fehlgeleitete Menschen über ihn gebracht haben. Auch hier entstand aus dem Bösen am Ende Gutes, sodass wir auch zu Beginn der Passionszeit über den Horizont hinaus Ostern im Blick haben können, die Auferstehung und das ewige Leben. Amen.
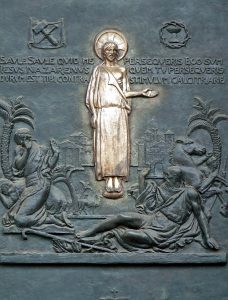
Reminiscere 2024
Text: Römer 5, 1-5.8
Liebe Leserinnen und Leser,
der Zirkusdirektor geht in meinem Zimmer unruhig auf und ab. Ich sitze am Schreibtisch und fertige ein Schriftstück für ihn an. Plötzlich nimmt er einen großen Nagel von der Wand, der einmal zur Befestigung des Turmkreuzes diente. Ihn erinnert der Nagel offenbar an etwas, denn er sagt: „Den Jesusfilm von Mel Gibson finde ich nicht gut. Das ist Gotteslästerung. Und man müsste auch all die Kreuze mit Jesus daran entfernen. So kommt der nie zur Ruhe.“
Ich murmele während des Schreibens etwas von Ostern und Auferstehung, aber er kommt immer wieder auf den Gekreuzigten zurück: „Vielleicht war das ja wirklich so grausam wie im Film. Und vielleicht sollen die Kreuze mit Jesus uns ja an ihn erinnern.“
 Erinnern, genau das ist die Übersetzung für den Namen des heutigen Sonntags: Reminiscere. Es ist der zweite Sonntag der Passionszeit, und da geht es in der Tat auch darum, uns an das Leiden Jesu zu erinnern. Aber der Film, auf den mein Gast damals anspielte, „Die Passion Christi“ von Mel Gibson aus dem Jahr 2004, belässt es bei der Erinnerung, die dem Zuschauer in sehr brutalen Szenen vor Augen geführt wird. So wurde der Film zum erfolgreichsten religiösen Film aller Zeiten. In der Passionszeit geht es für uns jedoch um mehr, nämlich darum, was das Leiden Jesu für uns heute bedeutet. Der Apostel Paulus schreibt darüber in seinem Brief an die Gemeinde in Rom Folgendes:
Erinnern, genau das ist die Übersetzung für den Namen des heutigen Sonntags: Reminiscere. Es ist der zweite Sonntag der Passionszeit, und da geht es in der Tat auch darum, uns an das Leiden Jesu zu erinnern. Aber der Film, auf den mein Gast damals anspielte, „Die Passion Christi“ von Mel Gibson aus dem Jahr 2004, belässt es bei der Erinnerung, die dem Zuschauer in sehr brutalen Szenen vor Augen geführt wird. So wurde der Film zum erfolgreichsten religiösen Film aller Zeiten. In der Passionszeit geht es für uns jedoch um mehr, nämlich darum, was das Leiden Jesu für uns heute bedeutet. Der Apostel Paulus schreibt darüber in seinem Brief an die Gemeinde in Rom Folgendes:
Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt: Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, sondern sogar über Nöte, die wir durchmachen, denn wenn wir durchzuhalten und uns bewähren, festigt sich unsere Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns durch den Heiligen Geist mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Er beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren.
Ungerechtigkeit ist ein schwerer Vorwurf, wenn er von Kindern gegenüber ihren Eltern oder von einem Angeklagten gegenüber einem Richter erhoben wird. Der Gerechtigkeitssinn ist bei den meisten Menschen noch fest verankert. Aber gibt es wirkliche Gerechtigkeit?
Wie ist das z. B. bei den Steuern: Wie viel Steuern müssten die Besserverdienenden zahlen, damit es am Ende gerecht zugeht, und wie stark müssten die ärmeren Schichten der Bevölkerung entlastet werden?
Gerechtigkeit in Bezug auf unsere Veranlagungen gibt es schon von Natur aus nicht, denn die Menschen sind, was die körperlichen und geistigen Fähigkeiten anbetrifft, höchst unterschiedlich. Dazu wird der Eine in der so genannten „Ersten Welt“, der andere in der so genannten „Dritten Welt“ geboren, der eine in einer armen, der andere in einer reichen Familie, der eine als Mann und die andere als Frau.
Selbst vor Gericht sind nur in der Theorie alle Menschen gleich: Der eine kann sich eine ganze Schar von Anwälten leisten, dem anderen bleibt der Pflichtverteidiger.
Dem Apostel Paulus geht es um eine Gerechtigkeit, die für alle Menschen gilt, die Gerechtigkeit aus dem Glauben: „Wir sind gerecht geworden durch den Glauben…“ schreibt er nach der Übersetzung Martin Luthers. Luther haderte zunächst selbst damit, dass er als Christ immer noch ein sündiger Mensch wäre, bis er erkannte, dass uns im Glauben die Gerechtigkeit zugesprochen wird, oder, wie es in der eben gehörten Übersetzung heißt: dass wir für gerecht erklärt worden sind, d. h. dass wir von Gott durch den Glauben gerecht gesprochen werden. Jedem Menschen steht der Weg des Glaubens offen: Wer Gott vertraut, der ist angenommen, ist gerechtfertigt vor ihm. Er muss sich nicht ständig selbst rechtfertigen und kann daher auch sich selbst besser annehmen.
Ein Sprichwort lautet: „Wo keine Gerechtigkeit ist, da ist auch kein Friede.“ Ganz ähnlich spricht Paulus vom Frieden, allerdings meint er zunächst einmal den Frieden mit Gott: Der Friede mit Gott ist die Auswirkung der Gerechtigkeit, die Gott uns allen zusprechen möchte.
Gott hat in Jesus Frieden mit den Menschen geschlossen. Schon bei der Geburt Jesu erklingt die Friedensbotschaft der Engel: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.“ (Lk 2,14). Und beim Abschied sagt Jesus zu seinen Jüngern: „Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch…“ (Joh 16,33)
Haben wir diesen Friedensschluss zur Kenntnis genommen? Er ist an keine Bedingungen geknüpft, außer dass wir die uns von Gott entgegengestreckte Hand erfassen…
Wenn Christen durch Glauben gerechtfertigt sind, dann muss das auch Auswirkungen auf ihr Verhältnis zueinander haben. Da ist dann kein Platz für ein Freund-Feind-Denken. Christen sollen aktiv mithelfen, Unrecht zu verhindern und Frieden zu schaffen. Ich bin Gott recht: Aber mein Mitmensch ist Gott eben auch recht!
Aus dem Frieden mit und in Gott gewinnen wir Maßstäbe für unseren Alltag, für zuhause, in der Berufs- und Schulwelt, im Umgang mit Freunden und Fremden.
Unserer Welt ist vom Frieden noch weit entfernt, manche meinen: so weit wie nie zuvor. Bilder aus der Ukraine, die wir seit zwei Jahren sehen, und aus den Gaza-Streifen stellen uns die Friedlosigkeit der Welt immer wieder vor Augen. Deutschland solle kriegstüchtig werden heißt es, Russland könne auch Deutschland angreifen und mache meine, wir brauchten in dieser Situation selber Atomwaffen.
Was bleibt uns da noch? Die Hoffnung!
Paulus schreibt: „In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht.“
Auch im Alltag ist die Hoffnung die treibende Kraft im Leben. Einem Kranken, der die Hoffnung auf Gesundung aufgegeben hat, kann auch der Arzt nicht mehr helfen, andererseits kann der vermeintliche Abstiegskandidat der Bundesliga über sich hinaus wachsen, solange er noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt hat.
In einem Gedicht von Manfred Rommel heißt es:
Wenig nützt der Pessimist, wenn die Sache schwierig ist.
Der Optimist nützt da schon mehr, denn er hebt die Stimmung sehr.
Eine oft gemachte Erfahrung lautet: Je größer das Leid, die Not oder die Bedrängnis ist, desto größer ist auch die Kraft, die uns gegeben wird, das auszuhalten, es zu ertragen. Pflegende Angehörige können davon berichten.
Das gilt auch für den Glauben. Wenn ich schwere Zeiten mittels des Glaubens überstanden habe, dann kann ich dankbar auf diese Erfahrung zurückschauen und daraus Hoffnung für die Zukunft gewinnen.
Christen sind keine hoffnungslosen Pessimisten, aber auch keine weltfremden Optimisten. Sie sind hoffnungsvolle Realisten. Ihre Hoffnung hat mit Ostern zu tun: Gott hat in Christus Leiden und Tod überwunden. Aber zu Ostern gehört auch der Karfreitag, d.h. das Leiden in dieser Welt, das man nie aus den Augen verlieren sollte. Christliche Hoffnung kann somit auch heißen, Gott im Leiden zu erfahren, es mit seiner Hilfe zu bewältigen und gestärkt und hoffnungsvoll daraus hervorzugehen
Liebe Leserinnen und Leser, wir sind Gott recht! Das bedeutet Frieden mit Gott zu haben und die Hoffnung selbst im Leiden nicht aufgeben zu müssen. Dies unseren Mitmenschen zu vermitteln, es ihnen in Worten und Taten begreiflich zu machen, das ist unser Auftrag als Christinnen und Christen.
Gott gebe uns für diese Aufgabe seinen guten Geist und einen langen Atem. Amen.
—————————
Nachtrag: Die Wege des Herrn sind unergründlich: Ausgerechnet der Schauspieler, der die Figur des Judas (in dem Film „Die Passion Christi“) spielte, war von dem Leiden Jesu, wie es in dem Film gezeigt wird, so berührt, das er sich bekehrte, Christ wurde, sich trauen und seine Kinder taufen ließ…
Invokavit 2024
Text: Matthäus 4, 1-11
Liebe Leserinnen und Leser,
ab letzten Mittwoch nehme ich wieder an der Aktion „7 Wochen ohne…“ teil. Es ist eine Fasten-Aktion der Evangelischen Kirche, an der inzwischen drei Millionen Menschen teilnehmen.

Sie hat nichts mit Zwang oder religiöser Pflicht zu tun, vielmehr entscheidet man sich dafür, sieben Wochen lang auf irgendetwas zu verzichten, um über seine Gewohnheiten beim Essen, Trinken oder anderen alltäglichen Dingen nachzudenken. Ich mache das seit Jahren und verzichte auf alkoholische Getränke und die Knabbereien am Abend. Nach 2-3 Wochen geht das meist ohne Probleme, aber die ersten Tage sind nicht so ganz einfach. Da bin ich schon mal in der Versuchung, doch ein Gläschen zu trinken oder die angebrochene Tafel Schokolade aufzuessen. In Versuchung zu geraten und ihr möglichst zu widerstehen, das ist Thema der heutigen Predigt. Sie basiert auf einem Abschnitt aus dem Matthäus-Evangelium. Dort heißt es:
Eines Tages wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Nachdem er vierzig Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte:
„Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden!“ Aber Jesus gab ihm zur Antwort: „Es heißt in der Schrift: ‚Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.‘“
Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die Heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: „Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter! Denn es heißt in der Schrift: ‚Er wird dir seine Engel schicken; sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt.‘“
Jesus entgegnete: „In der Schrift heißt es aber auch: ‚Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern!‘“
Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: „Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.“ Darauf sagte Jesus zu ihm: „Weg mit dir, Satan! Denn es heißt in der Schrift: ‚Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten; ihm allein sollst du dienen.‘“
Da ließ der Teufel von ihm ab.
1. Die Versuchung
Sie alle kennen vermutlich Manuel Neuer, den deutschen Fußballnationaltorwart. Im Juli 2011 ging er für 20 Millionen Ablösesumme zu Bayern München. Neuer stammt aus der Schalker Jugend und war in seiner Schalker Zeit zum Nationaltorwart geworden. Viele Schalker haben es ihm bis heute nicht vergessen, dass er zu den Bayern gegangen ist. Nach dem Wechsel wurde er gnadenlos ausgepfiffen, wenn er auf Schalke spielte. Seinen Wechsel hielten manche Fans für Verrat… Manuel Neuer verdient bei den Bayern inzwischen 21 Millionen Euro im Jahr, also mehr als 400.000 Euro pro Woche. Kann man es ihm da verdenken, selbst als Schalke-Fan, dass er zugegriffen hat? Man kann sich leicht über Andere erheben, die einer Versuchung unterliegen, in die man selbst nie kommen könnte. „Wer nicht versucht wird, der kann leicht fromm bleiben.“, sagt der Volksmund dazu.
Aber was für Versuchungen gäbe es denn für uns Otto-Normalverbraucher?
Als eine Art „Kavaliersdelikt“ gilt für viele Menschen Versicherungsbetrug: Allein in der Kraftfahrzeugsparte werden die Versicherer nach Schätzung von Experten jährlich um rund 1 Milliarde € betrogen. Versicherungsbetrug heißt es, sei zu einer Art Volkssport geworden. Von 20 Millionen regulierten Schäden seien rund 700.000 vorgetäuscht.
Oder die Versuchung, in der Ehe oder einer festen Beziehung untreu zu werden: Statistisch gesehen ist etwa ein Drittel aller Männer und Frauen dieser Versuchung schon einmal unterlegen. Oder gehen wir noch weiter ins Alltägliche: Wie oft sind Menschen in der Versuchung, jemanden zu beschimpfen, ihn lächerlich zu machen, über ihn zu lästern, Witze über ihn zu machen…
Der heutige Predigttext macht deutlich, dass solche Situationen zum Leben dazugehören. Und weil Jesus einer ist, der zu unserem Leben dazugehören möchte, sind ihm solche Situationen nicht fremd. Er ist darin ein Mensch wie wir. Die Versuchung ist ihm ebenso wenig fremd wie Leiden, Trauer oder Tod ihm fremd waren. Und weil das so ist, dürfen wir uns in solchen Momenten an ihn wenden. Gottes guter Geist, der Jesus in der Versuchung beigestanden hat, wird auch uns beistehen, wenn wir ihn darum bitten.
2. Macht und Gier
Vermutlich kennen Sie das Märchen vom Fischer und seiner Frau. Die beiden leben in einer armseligen Hütte, aber eines Tages angelt der Fischer einen Butt, der sich als verwunschener Prinz herausstellt und um sein Leben bittet. Der Fischer lässt ihn daraufhin umgehend frei. Als Ilsebill, seine Frau, das hört, fragt sie ihn, ob er sich denn nichts von dem Fisch gewünscht habe. Als er das verneint, drängt sie ihn, den Butt aufzusuchen und sich von ihm eine schöne neue Hütte zu wünschen. Diesen Wunsch erfüllt der Fisch, doch schon bald verlangt Ilsebill von ihrem Mann, dem Butt immer größere Wünsche vorzutragen. Sie verlangt zunächst, König zu werden, dann Kaiser und schließlich Papst. Alle Wünsche werden erfüllt, aber je maßloser Ilsebills Wünsche werden, desto mehr verschlechtert sich das Wetter bis hin zu einem fürchterlichen Sturm. Als die Frau jedoch am Ende wie der liebe Gott werden will, wird sie wieder zurück in ihre armselige Hütte versetzt.
Das Märchen ist ein Beispiel dafür, wie die Gier einen Menschen in die Versuchung treiben kann, immer mehr und mehr zu wollen, ohne Rücksicht auf Andere, ohne Rücksicht auf das schlechter werdende Wetter, wir könnten vielleicht auch sagen: auf das schlechter werdende Klima. Aus der Erfüllung des ersten Wunsches erwuchs die Versuchung, sich immer mehr zu wünschen. Ihr Wunsch, Papst zu sein, ist schon völlig absurd, aber auch das reicht ihr bekanntlich nicht.
Ich komme nicht umhin, hier an die Politik zu denken: Im Frühjahr 2014 besetzte und annektierte Russland völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim und gliederte sie in das russische Reich ein. Da es keinen nennenswerten internationalen Widerstand gab, war die Versuchung groß, die gesamte Ukraine zu erobern. Das Ergebnis haben wir seit fast zwei Jahren jeden Tag vor Augen.
Oder ich denke an die Versuchung Chinas, Taiwan zu erobern und damit vielleicht einen dritten Weltkrieg auszulösen.
Oder an die Versuchung einiger israelischer Politiker, nach der berechtigten militärische Antwort auf den barbarischen Überfall der Hamas jetzt die Region mit Gewalt neu zu ordnen.
Da kann man nur bitten: Herr, führe sie nicht in Versuchung…
3. Das Wort Gottes
Manchmal vertrete ich KollegInnen bei Gottesdiensten, in deren Rahmen auch Taufen stattfinden. Die Mitarbeiterinnen in den Gemeindebüros weisen die Eltern stets sehr deutlich darauf hin, dass Taufsprüche aus der Bibel stammen müssen. Das ist gut so und gilt im Übrigen auch für Trau-Sprüche, Konfirmations-Sprüche oder Worte zur Bestattung. Und auch die sonntägliche Predigt beruht ja immer auf einem biblischen Text. Die evangelische Kirche ist eine „Kirche des Wortes“.
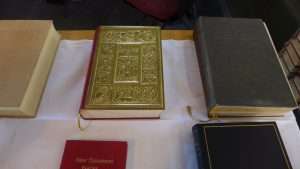
In meiner früheren Gemeinde folgt auf das so genannte Schuldbekenntnis, das der Pastor stellvertretend für die Gemeinde spricht, der Gnadenzuspruch. In meiner Anfangszeit habe ich den manchmal frei formuliert, bis mich ein älterer Kollege in freundlicher Weise darauf hinwies, dass es für ihn eine ganz andere Qualität habe, wenn diese Gnadenzusage durch ein biblisches Wort erfolgen würde.
Die Wertschätzung für das Wort Gottes findet sich auch in unserem Predigttext. Jesus wehrt sich gegen jede Versuchung mit einem Wort Gottes. Selbst für ihn war es offenbar eine wertvolle Hilfe, sich auf das Zeugnisse der Heiligen Schrift verlassen zu können.
Warum sind Worte der Heiligen Schrift für viele Menschen so wichtig? Zum einen haben sie eine lange Tradition, sind schon vielen Menschen wichtig geworden, da muss also was dran sein. Zu anderen sind uns bestimmte Texte, wie das Vaterunser, durch den häufigen Gebrauch vertraut und wir können auf sie zurückgreifen, wenn uns etwa die Worte zum Beten fehlen. Vor allen der sind es Worte von Menschen, die sie aus einem tiefen Glauben heraus gesprochen oder niedergeschrieben haben. Und darum können diese Worte auch für uns wichtig und zum Wort Gottes werden. Amen.
Estomihi 2024
Text: Lukas 10, 38-42
Liebe Leserinnen und Leser,
ein älterer und ein jüngerer Pastor sitzen bei einer Synode in der Mittagspause zufällig nebeneinander. Einmal fragt der ältere Kollege: „Worüber predigen Sie denn am nächsten Sonntag?“ Der junge Kollege antwortet: „Über den vorgeschlagenen Text, die Geschichte von Maria und Marta.“ „Das sollten sie sich aber nochmal überlegen!“, sagt der Ältere, und beginnt zu erzählen: „Ich war gerade zwei Jahre in meiner ersten Pfarrstelle, da bekam ich es mit diesem Predigttext zu tun. Er schien mir geeignet, die geistliche Seite unseres Gemeinde-Lebens zu betonen. Am wichtigsten sei es doch, auf das Wort Gottes zu hören, alles andere sei zweitrangig. Wie das bei den Leuten ankam, erfuhr ich in der folgenden Woche. Wir hatten Frauenhilfe und dazu waren Gäste aus unserer Partnergemeinde eingeladen. Es sollte wie immer Kaffee und Kuchen geben. Normalerweise duftet es schon Stunden vorher im ganzen Gemeindehaus nach Kaffee und Gebäck. Diesmal nicht. Ich ahnte nichts Böses, bis ich den Gemeindesaal betrat. Da standen weder Tassen noch Teller, keine Dekoration, kein Kaffee war fertig, lediglich der bestellte Kuchen stand in Pappkartons auf einem kleinen Tischchen. Ich ließ mir für die Gäste schnell eine Entschuldigung einfallen, dann brachte ich den Nachmittag mit einem schlechten Gefühl und ohne Kaffee zu Ende.
Als die Gäste gegangen waren, fragte ich die Küsterin. „Tja“, sagte sie, „ich wollte ja heute Vormittag alles herrichten, aber dann wurde da Fernsehen ein Gottesdienst vom Kirchentag übertragen, und Sie haben doch selbst gesagt, hören sei wichtiger… Na und die Damen, die mir sonst helfen, haben auch lieber den Fernseher angeschaltet.“ „Tja“, sagte der Ältere, „was soll ich ihnen erzählen? Der Senioren-Kreis bekam keinen Kaffee und musste in verstaubten Räumen tagen, der Gemeindebrief wurde nicht mehr ausgetragen, der Gemeindekirchenrat wollte von mit nur noch Andachten und Bibelauslegungen hören, aber niemand war mehr zum Arbeiten bereit. Ich musste mit Engelszungen reden, um die Sache wieder in den Griff zu bekommen.“
Soweit diese kleine Episode. Ich hoffe, Sie sind neugierig auf den Predigttext aus dem Lukasevangeliums geworden:
Auf dem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und seine Schüler in einen Ort, wo sie von einer Frau namens Marta zum Essen eingeladen wurden. Die Schwester von Marta hieß Maria. Die war immer ganz nahe bei Jesus und hing förmlich an seinen Lippen. Marta dagegen war die ganze Zeit in der Küche und bewirtete die Gäste. Irgendwann war sie echt genervt und meinte zu Jesus:
„Siehst du nicht, wie ich hier schufte, und meine Schwester sitzt die ganze Zeit nur rum und hilft mir nicht? Kannst du ihr nicht sagen, sie sollte mal in die Küche gehen?“ Jesus sagte zu ihr: „Meine liebe Marta, mach dir keinen Kopf um solche Sachen. Jetzt gibt es gerade nur eine Sache, die wirklich wichtig ist. Deine Schwester hat sich für das Richtige entschieden, das kann ich ihr nicht verbieten.“
Mich erinnert der Text an einen Film, der im Lutherjahr 2017 in der ARD lief: „Katharina Luther“.
Katharina von Bora lebte als Nonne das für sie bestimmte Leben, bis sie mit Anfang 20 durch die Schriften Martin Luthers mit völlig neuen Gedanken in Berührung kam. Sie floh aus den Kloster und kam ohne Einkommen und von ihrer Familie verstoßen nach Wittenberg, wo sie Martin Luther begegnet. Einige Jahre später heiratet sie den Reformator und wurde als seine Ehefrau zu einer erfolgreichen Wirtschafterin, zur gleichberechtigten Gesprächspartnerin und Mutter ihrer gemeinsamen Kinder. Es heißt, dass sie die theologische Arbeit ihres Mannes „auf ein solides finanzielles Fundament“. stellt Sie erwarb Grundbesitz, organisierte des gesamten Haushalt mit Vieh und Landwirtschaft, leitete das Personal an und organisierte Lehraufträge für ihren Mann. So kam die Familie Luther kam zu einem ansehnlichen Wohlstand.
War Katharina Luther von einer „Maria“ zu einer „Marta“ geworden?
Bevor wir diese Frage entscheiden, kommen wir noch einmal zurück zu unserem Predigttext. Für viele klingt er beim ersten Hören unbefriedigend: Eine Frau aus meiner früheren Gemeinde sagte: „Ich habe die Geschichte noch nie leiden können. Da wird doch der Wert der Hausfrauenarbeit herabgesetzt! Was Jesus hier sagt, ist nicht fair gegenüber Marta!“ Wahrscheinlich denken viele so. Aber es steckt mehr in dieser Geschichte, als man beim ersten Hören wahrnimmt.
Meiner Meinung nach stecken in der Geschichte zwei Frauen, die jede auf ihre Weise Vorbild für uns sein können, so unterschiedlich sie auch sind.

Es gab eine ganze Reihe von Nachfolgerinnen Jesu. In den frühen christlichen Gemeinden hatten Frauen sogar wichtige Funktionen inne, etwa als Leiterinnen von Hausgemeinden. Erst später wurde die Rolle der Frau in den Gemeinden wieder zurückgedrängt. Wir können uns Maria deshalb durchaus als ein Frau vorstellen, die nicht nur zuhörte, sondern mitredete über Gott und die Welt, denn der Glaube an den Gott, den Jesus verkündete, war ihr Ein-und-alles.
Marta war aus ganz anderem Holz geschnitzt: Sie war eine tatkräftige, gastfreundliche Frau. Sie hatte Jesus eingeladen mitsamt allen, die mit ihm zogen, fünfzehn oder zwanzig, vielleicht sogar dreißig Leute. Da hatte sie natürlich alle Hände voll zu tun, um ihnen ein nahrhaftes Essen vorzusetzen. Sie war aktiv, zupackend, ja sie traute sich sogar, Jesus anzusprechen und ihm gewissermaßen Vorwürfe zu machen.
Jesus sagt nicht, Marta solle sich nun auch schnell hinsetzen und zuhören, sondern nur, sie solle Maria gewähren lassen. Und dass sie sich nicht um alles Sorgen machen solle, denn das Sorgen sei eine Haltung, die dem Reich Gottes nicht entspräche. Er kritisiert also nicht die Tätigkeit Martas, sondern die Art und Weise, wie sie sich davon gefangen nehmen lässt.
Ich glaube übrigens, Jesus schätzt beide Frauen sehr…
Kommen wir noch einmal auf den Pastor aus unserer Anfangsgeschichte zurück. Er hatte schmerzlich erkennen müssen, dass in der Gemeinde die „Martas“ unersetzlich sind. Martas, dass sind Frauen, die etwas Handfestes tun, beim Basar oder beim Kirchlichtfest, spülen, das Essen servieren, einkaufen usw. Es gibt in unseren Gemeinden natürlich auch männliche Martas, wenn man das so sagen kann, Männer, die anpacken, Bänke schleppen, nach der Heizung im Gemeindehaus stehen oder den Kirchplatz fegen. Wie gut ist es, dass wir Martas haben!
Das Lukas-Evangelium, aus dem unser Predigttext stammt, ist ein Beleg dafür, wie wichtig unser Tun für Christenmenschen ist. Vor unserem Predigttext steht dort das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, wo die Frommen den Sterbenden liegen lassen und einer, der nicht religiös war, zupackt und dem Überfallenen das Leben rettet…
Den Gottesdienst zu besuchen, in der Bibel zu lesen, zu beten, zuzuhören und sich etwas sagen zu lassen, das ist die andere Seite des Gemeindelebens. Wer heute den Gottesdienst besucht und/oder diese Predigt liest, für den hat auch diese Seite des Lebens eine große Bedeutung.
Ohne die „Martas“ gäbe es kaum Aktivitäten in unserer Kirche, aber ohne die „Marias“ wären wir nichts anderes als ein Verein.
Es wäre mehr als bedauerlich, wenn wir in unseren Gemeinden nur die eine oder nur die andere Gruppe von Menschen vorfinden würden. „Wir müssen nicht wählen zwischen Hören und Handeln. Niemand darf uns diese Wahl aufzwingen. Wir brauchen beide, Maria und Marta…“ schrieb die Theologin Dorothe Sölle. Und Martin Luther sagte, vielleicht augenzwinkernd mit dem Blick auf seine Frau: „Der Glaube ist das Eine, das nottut. Aber er ist ein aktives, schaffendes Ding, das unaufhörlich Gutes tut.“
So wie wir in unseren Gemeinden beide Arten von Menschen finden, und natürlich ganz viele Zwischentöne, so sind auch bei den Meisten von uns beide Anteile vorhanden. Es gibt in uns Anteile von Maria und Anteile von Marta. Manchmal gleichen wir mehr der einen, manchmal mehr der anderen… Wir sollten diese Anteile nicht gegeneinander ausspielen, vielmehr sollten sie sich ergänzen…
Ich vermute, dass bei vielen Menschen der Anteil, den Maria verkörpert, oft ins Hintertreffen gerät. Kaum jemand hat mehr Zeit für sich selbst und für andere, und wir alle machen uns viel Sorgen, manche sehr berechtigt, viel aber auch unnötig. So machen wir es der Maria in uns nicht leicht. Aber ohne das Hören auf das Wort Gottes gibt es keinen Glauben, und ohne Glauben verliert unser Handeln die Richtung.
Kommen wir noch einmal zu Katharina Luther und der Frage, ob sie von einer Maria zu einer Marta geworden war. Ich denke nicht: Sicher hat sie auch im Kloster gearbeitet und sicher hat sie als Wirtschafterin, Ehefrau und Mutter ihren Glauben nicht verleugnet. Immer waren auch in ihr Anteile von Maria und Anteile von Marta, nur traten sie zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark zu Tage.
Ich wünsche uns allen, dass wir sowohl die Marta als auch die Maria in uns entdecken können, und dass sie beide in unserem Leben zum Zuge kommen.
Amen.
Sexagesimae 2024
Text: Johannes 2, 1-11
Liebe Leserinnen und Leser,
immer wieder gibt es Berichte über so genannte „Schönheitsoperationen“: Menschen lassen sich neue Backenknochen anfertigen, Fettpolster abtragen, die Nase verkleinern oder den Busen vergrößern. Operationen dieser Art sind äußerst umstritten: Ist das noch ärztliche Kunst zum Wohl der Menschen oder ist nur Geschäftemacherei? Viele Menschen sprechen in diesem Zusammenhang von „Luxusoperationen“, weil ja meistens keine wirkliche Notwendigkeit für diese Eingriffe bestehe.
Ähnliches könnte man auch bezogen auf den heutigen Predigttext sagen: Das Wunder, das Jesus hier vollbringt, wird von manchen Auslegern tatsächlich als „Luxuswunder“ bezeichnet. Johannes berichtet davon im zweiten Kapitel seines Evangeliums:
Zwei Tage nach der Taufe Jesu fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil, und Jesus und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: „Sie haben keinen Wein mehr!“ Jesus erwiderte: „Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen.“ Aber seine Mutter wandte sich an die Diener und sagte: „Tut alles, was er euch sagt!“
In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen achtzig und hundertzwanzig Liter. Jesus sagte zu dem Dienern: „Füllt diese Krüge dort mit Wasser!“ Das taten sie. Dann sagte Jesus zu ihnen: „Gebt etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist.“ Auch das taten sie. Der Mann wollte das Wasser probieren, da war es zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam; nur die Diener wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte: „Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurück-behalten!“
Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte damit seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
Die Menschlichkeit Jesu

In der Tat, dieses Wunder passt auf den ersten Blick so gar nicht zu unserem Jesus-Bild: Menschen heilen, predigen, Streitgespräche über den Glauben führen, in die Synagoge gehen, das verbinden wir ja gewöhnlich mit dem Mann aus Nazareth. Dieses Wunder aber passt irgendwie nicht in unser Bild von Jesus hinein. Es scheint überflüssig zu sein, denn es bestand ja keine unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben. Dennoch findet sich dieser Text an einer wichtigen Stelle im Johannes-Evangelium, in dem ansonsten nur sehr wenige Wunder berichtet werden: Es ist das erste Wunder, das Jesus vollbrachte und es kennzeichnet den Beginn seines öffentlichen Wirkens.
In erster Linie geht es meiner Meinung nach hier um den Menschen Jesus. Was ist das für einer, werden sich die Leute damals gefragt haben, fragt mancher sich auch heute. Ein Mensch jedenfalls, der offensichtlich gern feierte, der sich unter die Leute mischte, der auf eine Hochzeit von vermutlich nicht sehr wohlhabenden Menschen ging, der mit Menschen zusammen war „wie du und ich“. Weil er die Nähe zu den Menschen suchte und daher gern mit ihnen feierte, aß und trank, wurde er oft genug angefeindet. Vermutlich waren es hauptsächlich die besonders Frommen, die ihn nach dem Bericht des Evangelisten Matthäus mit den Worten angriffen: „Dieser Mensch ist ein Vielfraß und Weinsäufer.“ Mit seiner Menschennähe und seiner Lebensfreude unterschied er sich übrigens auch deutlich von seinem Vorläufer Johannes.
Zurück zu unserem Predigttext: Eine Hochzeitsfeier dauerte damals in der Regel sieben Tage, und Wein war das Getränk schlechthin. Wenn der Wein vor dem Ende des Festes zur Neige ging, war das eine Katastrophe für den Bräutigam. Das würde er noch nach Jahren hören, voller Spott: An deine Hochzeit war ja nicht einmal genug Wein vorhanden… Genau vor dieser Situation stand der Bräutigam in Kana. Wieso es dazu gekommen war, wird nicht gesagt. Vielleicht waren mehr Gäste gekommen, als er erwartet hatte, vielleicht hatten sie mehr als üblich getrunken.
Jesus ließ das Brautpaar in dieser misslichen Situation jedenfalls nicht allein, auch wenn er sicher nicht die Absicht hatte, an diesem Tag ein Wunder zu vollbringen. Aber um der beiden Menschen in dieser misslichen Lage willen, tat er es doch.
Mit diesem Jesus betrat ein außergewöhnlicher Mensch die Bühne des Geschehens, vor allem aber trat mit ihm Gottes Menschenfreundlichkeit ins Scheinwerferlicht der Geschichte.
Die Worte Jesu
Maria war es, die Jesus auf die prekäre Situation des Bräutigams aufmerksam machte. Er verstand sofort, was seine Mutter von ihm erwartete. Seine Reaktion aber ist sehr überraschend: „Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau?“, sagt er, oder in anderer Übersetzung: „Was geht es dich an, Frau, was ich tue?“ Wörtlich übersetzt steht da : „Was ist dir und mir gemeinsam, Frau?“
In der Bibel gibt es keine Verherrlichung Marias, im Gegenteil: Im Johannes-Evangelium beispielsweise wird Maria nur zwei Mal erwähnt, und zwar jedes Mal ohne ihren Namen zu nennen. Hier in der Geschichte findet sich sogar die schroffe Ablehnung durch Jesus, der doch sonst den Menschen immer voll Freundlichkeit begegnete. Der Verwandtschaftsgrad zu Maria war offenbar für ihn ohne jede Bedeutung. Seine Mutter aber sagte trotzdem zu den Dienern: „Tut alles, was er euch sagt!“
Und in der Tat, trotz seiner harten Worte an Maria sagte Jesus den Dienern, was sie tun sollten und am Ende wurde Wasser zu wohlschmeckendem Wein.
Maria hat Jesus zeitlebens missverstanden und vermutlich erst nach seinem Tod und seiner Auferstehung an ihn geglaubt. Aber ihre Haltung bei der Hochzeit war trotzdem vorbildlich:
– Sie wandte sich mit ihrem Anliegen an die richtige „Adresse“, an Jesus.
– Sie half dem Brautpaar uneigennützig und ohne dass es jemand von den Gästen bemerkte.
– Vor allem aber war ihr Ausspruch „Tut alles, was er euch sagt!“ ein Anreiz für uns, zu tun, was er uns sagt.
Und was ist das, was er uns heute sagen würde? Als Jesus einmal gefragt wurde, welches das höchste Gebot sei, antwortete er: „Du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Und allen Betrübten rief er zu: „Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet: Ich werde sie euch abnehmen!“ Das sind zentrale Worte Jesu, die heute noch genauso aktuell sind wie damals.
Das Vertrauen zu Jesus
Bei den Wundergeschichten in den Evangelien stellen sich mir immer wieder drei Fragen:
– Was ist damals passiert?
– Warum ist es passiert bzw. was sollte damit ausgedrückt werden?
– Was haben wir heute davon?
Was passiert ist, können wir nur am Ergebnis feststellen: Wasser wurde zu Wein, der wurde anschließend getrunken. Selbst wenn man noch ein Amphore mit diesem Wein finden würde: Er wäre ungenießbar. Auf dieser Ebene hat das Wunder also heute keine Bedeutung mehr.
Damit zu der Frage, warum das Wunder überhaupt geschah. Einmal um zu zeigen, dass dieser Jesus ein Mensch war, dem die Bedürfnisse anderer Menschen, also auch unsere, nicht gleichgültig sind.
Der zweite Grund aber wird deutlich beim Blick auf die Jünger Jesu. Von Ihnen wird zu Anfang nur erwähnt, dass sie mit dabei waren. Am Ende aber heißt es: „Jesus offenbarte damit seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.“
Das eigentliche Wunder bestand damals darin, dass Vertrauen entstehen konnte, dass die Jünger nach diesem Wunder an Jesus glauben konnten.
Genau auf Letzteres, auf den Glauben an und das Vertrauen zu Gott, läuft die Geschichte hinaus. Wunder wecken nicht automatisch Glauben, aber sie können Zeichen und Hinweise sein. Für die Jünger waren sie damals die letzte Bestätigung, dass sie Jesus glauben und ihm vertrauen konnten.
Möge dieses Wunder auch bei uns immer wieder geschehen.
Amen.
Letzter Sonntag nach Epiphanias 2024
Text: Matthäus 17, 1-9
Liebe Leserinnen und Leser,
manchmal hört man über einen Menschen, er habe sich in letzter Zeit sehr verändert. Das kann positiv, aber auch negativ gemeint sein. Manchmal passiert solch eine Veränderung in einem langen Prozess, manchmal geschieht sie schlagartig, etwa wenn der Zug, den ich verpasst habe, einen schweren Unfall hat und mir mit einem Mal klar wird: Ich hätte jetzt auch tot sein können…
Im heutigen Predigttext geht es auch um eine plötzliche Veränderung. Der Text steht im 17. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Dort heißt es:
Sechs Tage nachdem Jesus zum ersten Mal über sein bevorstehendes Leiden gesprochen hatte, stieg er mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einen hohen Berg. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen ihnen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten.
Da rief Petrus: „Herr, wie gut ist es, dass wir hier sind! Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.“
Während er noch redete, kam eine helle Wolke, aus der eine Stimme sprach: „Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude, und auf ihn sollt ihr hören!“
Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen. Jesus aber trat zu ihnen, und sagte: „Steht auf! Ihr braucht euch nicht zu fürchten.“ Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus.
Ob uns diese seltsame Geschichte heute noch einen Anstoß geben kann, über unseren Glauben nachzudenken? Lassen wir es darauf ankommen!
Am Anfang des Textes heißt es, das Ereignis sei „nach sechs Tagen“ eingetreten, also am siebten Tag. Das ist ganz offensichtlich eine Parallele zur Schöpfungsgeschichte: Nach sechs Tage ruhte Gott von seiner Arbeit aus und der siebte Tag wurde der Höhepunkt der gesamten Schöpfung. Die wundersame Veränderung, die mit Jesus geschah, hat demnach also einen ganz besonderen Stellenwert, sie ist abgehoben von anderen alltäglichen Ereignissen.
Unser Glaube beschränkt sich nicht auf einen Tag in der Woche, im Gegenteil: An sechs Tagen muss sich der Glaube im Alltag bewähren, an einem Tag, am Sonntag, können wir zur Ruhe kommen und auftanken. Der Wechsel von Sonn- und Alltag ist für uns ebenso wichtig wie der Wechsel von Tag und Nacht, schlafen und wach sein, arbeiten und essen, Ferienzeit und Berufsalltag.
Sonntag und Alltag haben eine Wechselwirkung aufeinander. Jesus und die drei Jünger haben nicht sechs Tage in der Woche solche Erlebnisse wie das oben geschilderte. Vielmehr ist dieses Ereignis eine Ausnahme, davor und danach herrscht wieder Alltag. Allerdings waren die Jünger nach den Geschehnissen am siebten Tag nicht mehr die „Alten“, das Erlebnis am Sabbat hatte sie verändert und prägte nun auch irgendwie ihren Alltag.
Der Sonntag will uns auch heute aus dem Alltag mit seinen Sorgen und Ängsten, Herausforderungen und Anstrengungen herausholen. Sonntage sind wie ein geistlicher Vitaminstoß oder ein geistliches Auftanken, oder besser gesagt: Sie könnten so etwas für uns sein. Leider geht das Verständnis für die tolle Gabe des Sonntags immer mehr verloren. Für viele Menschen hat er seine geistliche Dimension längst verloren. Vielleicht ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, was wir damit verschenken…
Wenn wir uns am Sonntag in Gedanken auf den Berg der göttlichen Offenbarung mitnehmen lassen, dann kann sein Glanz die Wege unseres Alltags heller und klarer machen.

Bei Trauungen werde ich oftmals gefragt, ob dabei fotografiert oder gefilmt werden dürfe. Die Brautpaare möchten den vermeintlich entscheidenden Augenblick, das gegenseitige „Ja“, den Kuss nach der Trauung oder den Segen des Pastors festhalten, ihn konservieren. Obwohl ich selber Hobby-Fotograf bin und eigentlich nichts dagegen habe, hat das Ganze doch auch Nachteile: Wenn das Paar sich ständig von der Kamera beobachtet fühlt, immer für die Kamera lächeln muss, fällt es schwer, sich auf das eigentliche Geschehen zu konzentrieren. Man nimmt das aber hin, weil ja alles aufgenommen wird und man es sich zu Haus nochmal ansehen kann. Oft verhindert das Filmen auf diese Weise, konzentriert zuzuhören und sich die Worte zu Herzen zu nehmen.
Ganz ähnlich ergeht es Petrus. Natürlich hatte er kein Handy und keine Kamera, aber er ist so beeindruckt von dem Geschehen, dass er drei Hütten bauen möchte, um diesen besonderen Augenblick irgendwie festhalten zu können. Aber was wäre da festzuhalten? Die Hütten aus Laub und Ästen wären nach kurzer Zeit zerfallen.
Was aber viel wichtiger ist: Was Gott den Menschen geben möchte, ist völlig unabhängig von einem besonderen Ort, einer Hütte oder Kapelle. Was Gott den Menschen geben möchte, ist nicht irgendetwas, sondern alles, nämlich sich selbst in der Person Jesu. Das in einer armseligen Hütte festhalten zu wollen, ist ebenso unsinnig, als würde ein Vater das Erlebnis, bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein, durch ein Video ersetzen wollen, das die Hebamme für ihn aufgenommen hätte…
Deshalb unterbricht eine gewaltige Stimme die Überlegungen von Petrus: „Ihr müsst keine Hütten oder Kathedralen bauen, ihr braucht nur auf die Stimme Jesu zu hören.“
Kirchen oder Kathedralen sind etwas Festes, Statisches, sie bleiben für immer am selben Ort. Unser Glaube dagegen ist nicht für alle Zeiten gleichbleibend. Er verändert sich: An manchen Tagen fühlt man sich Gott sehr nahe, an anderen fragt man sich, ob nicht alles nur Einbildung gewesen sei. Und auch im Lauf eines Lebens gibt es Veränderungen, beispielsweise von einem naiven kindlichen Glauben hin zu einem Erwachsenen-Glauben.
Die Kirche hat im Laufe der Jahrtausende viele „Hütten“ gebaut, darunter wunderschöne, große und kleine, nicht selten architektonische Meisterleistungen. Wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir aus finanziellen Gründen manche Kirche aufgeben müssen. Das ist teilweise sehr schmerzhaft. Die Nähe zu Gott aber können wir auch an anderen Orten finden, wenn wir es wirklich wollen.
Die spürbare Gegenwart Gottes versetzte die Jünger zunächst Schrecken, ähnlich wie bei den Hirten auf dem Feld, als ihnen die Geburt Jesu angekündigt wurde.
Nun gibt es durchaus ein heilsames Erschrecken: Ich gehe am ersten Wintertag mit normalen Schuhen aus dem Haus, rutsche aus, lande auf dem Boden. Ich habe mich erschrocken, aber ich gehe rein, ziehe mir andere Schuhe an und fahre danach zur Autowerkstatt, um mir Winterreifen aufziehen zu lassen. Ein solches Erschrecken ist natürlich sehr positiv. Ein Erschrecken aber, dass mit Angst und Schrecken verbunden ist, ist eine ganz andere Sache und hat mit Gott nichts zu tun. Im Gegenteil: Gott möchte uns nicht erschrecken, möchte uns keine Angst einflößen, obwohl die Kirche das viele Jahrhunderte über so praktiziert hat. Nein, die Absicht Gottes ist es, uns mit seinem Wort und seinem guten Geist aufzurichten! Das Bild des strahlenden Jesus soll sich uns einprägen als Gegenbild zu Angst, Schrecken und Not. Auf den zu hören, den wir den Sohn Gottes nennen, kann uns Kraft geben, die Widrigkeiten des Lebens zu überstehen. Gott lässt auf dem Gesicht Jesu seine Liebe zum Menschen aufscheinen, er macht das Angesicht Jesu zum Licht der Welt.
Am Ende der Geschichte sind die Jünger wieder mit Jesus allein, sie verlassen den Berg, die Erde hat sie wieder. Aber sie kehren anders zurück als sie gekommen sind. Sie kehren zurück mit dem Bild Jesu in ihren Herzen, zu dem sich Gott bekannt hat. Das Licht Gottes, das auf Jesu Antlitz sichtbar wurde, macht ihren Alltag hell, sodass keine Ängste und Sorgen sie niederdrücken können.
Dieses göttliche Licht, das Jesus erleuchtete, will auch in unseren Herzen scheinen, es will unsere Kraftquelle im Alltag werden.
Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wer sich selber ansieht, leuchtet nicht.“ Weil Jesus sich nicht selber ansieht, sondern den Blick auf seinen himmlischen Vater richtet, deshalb kommt an ihm und in ihm Gottes Licht zum Ausdruck.
Auch die Gemeinde Jesu Christi darf sich von diesem Licht bestimmen lassen: Gottes Liebe kommt zum Ziel, wo wir uns ihr öffnen und unser Leben von ihm erleuchten lassen. Amen.

3. Sonntag nach Epiphanias 2024
Text: Johannes 4, 46b – 54 i. A.
Liebe Leserinnen und Leser,
vor über 50 Jahre hat die Schlagersängerin Katja Epstein den dritten Platz beim Eurovision Song Contest (1970) mit einem Lied gewonnen, in dem es heißt:
„Wunder gibt es immer wieder,
heute oder morgen können sie gescheh’n…“
Ich weiß nicht, woran Sie heute bei diesen Zeilen denken, vielleicht an Ereignisse, über die man sich wundern kann; wenn sich z. B. verfeindete Menschen plötzlich die Hand reichen, oder wenn sich jemand, der als sehr egoistisch gilt, mit einem Mal für Menschen in Not einsetzt.
Auch in der Bibel ist immer wieder von Wundern die Rede. Es wird berichtet, dass Jesus besonders viele Wunder vollbracht habe. Dabei geht es den biblischen Erzählern nie darum, Jesus als einen großen Wunderheiler darzustellen, sondern darum, die Menschen zum Nachdenken zu bringen und deutlich zu machen, dass dieser Jesus nicht „irgend-wer“ ist.
Auch der heutige Predigt-Text beinhaltet eine Wunder Geschichte. Und auch hier ist nicht das Wunder, die Heilung eines Kindes, das Entscheidende ist. Vielmehr geht es um die Frage, welches Vertrauen die Menschen Jesus entgegenbringen können. Der Text steht im vierten Kapitel des Johannes-Evangeliums. Dort heißt es:
Eines Tages kam Jesus wieder einmal nach Kana, jenem Ort in Galiläa, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, dessen Sohn an einer schweren Krankheit litt. Der Mann bat Jesus händeringend darum, zu ihm nach Hause zu kommen und seinen Sohn zu heilen, denn der läge im Sterben. Er flehte Jesus an: „Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt!“ Da sagte Jesus zu ihm: „Geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund!“ Der Mann glaubte ihm das und machte sich auf den Weg in sein Dorf. Er war noch nicht dort angelangt, da kamen ihm seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebe und gesund sei. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. „Gestern Mittag um ein Uhr hatte er mit einem Mal kein Fieber mehr“, antworteten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte: „Dein Sohn lebt und ist gesund!“ Und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus.
Eine Wundergeschichte, weil ein Kind geheilt wird. Aber auch eine Wundergeschichte, weil sich ein Mensch verändert und bereit ist, über seinen Schatten zu springen. Versuchen wir uns für einen kurzen Augenblick, in ihn hinein zu versetzen:
Seit Wochen sitzt er jede Nacht am Bett seines Kindes, tut kein Auge zu, hält ihm die Hand, kühlt ihm die Stirn, geht morgens müde und sorgenvoll zur Arbeit, ist unkonzentriert, kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Er lässt die besten und teuersten Ärzte kommen, und sie sagen ihm: Es gibt keine Hoffnung mehr.
Das aber will er nicht wahrhaben. Es wäre ihm gleich, ob ihm ein Wundertäter, ein Priester, oder ein Magier helfen würde, nur dass seinem todkranken Kind geholfen wird.
Das kennen wir auch heute noch: Eltern, deren Kinder schwer erkrankt sind, greifen nach jedem Strohhalm. „Wer heilt, hat Recht…“, sagt mein Hausarzt. Wer könnte da dem verzweifelten Vater seine Gedanken verübeln?!
Er ist schon lange nicht mehr der mächtige königlicher Beamte, in diesen Wochen ist er nur noch Vater, einer, der seinen Sohn mehr liebt als sich selbst. Mögen andere seinen Sohn abgeschrieben haben, er ist nicht bereit, das scheinbar Unabänderliche hinzunehmen.
So denken wir als Eltern doch auch: Gott möge unser Kind beschützen, es ist doch das Wertvollste was wir habe. Und wir hoffen, das Gott seinen Engeln befehlen möge, unsere Kinder auf Flügeln zu tragen.…
Der Vater hört sich um: Weiß niemand einen Rat? Kennt niemand einen, den er um Hilfe bitten könnte? Und dann bekommt er tatsächlich einen „heißen Tipp“:
Meinst du den Wanderprediger, der hier in der Nähe wohnt? Von dem habe ich früher schon mal gehört, gute Idee. Hol ihn her… Wie, er ist gar nicht zu Hause, sondern in Kana? Vielleicht ist er mein letzte Rettung…
Er lässt alles stehen und liegen und läuft los. Und er spürt: Hier kann er nichts befehlen oder anordnen, hier nutzen ihm seine königliche Macht nichts. Er kommt als Bittsteller und kann nur hoffen, dass der Prediger einwilligt und mitkommt zu seinem todkranken Kind. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät…
Das eigentliche Wunder ist in diesem Augenblick schon geschehen: Die Liebe zu seinem Kind ist stärker als der Stolz des Vaters. Und das Vertrauen des mächtigen Mannes in den Wanderprediger, so klein es am Anfang noch gewesen sein mag, es ist ganz langsam gewachsen und am Ende belohnt worden.
Führen wir uns noch einmal die drei Schritte vor Augen, die den Mann zu einen solchen Haltung geführt haben.
Der erste Schritt heißt „Selber gehen“
Es gibt Wege, die können andere Menschen für uns gehen können: Mein Nachbar kann für mich Brötchen holen, wenn ich krank bin, ich kann für meine alte Tante zur Apotheke gehen usw. Andere Wege aber muss man unbedingt selber gehen: den Weg zum Zahnarzt, zur Führerscheinprüfung, zu dem Menschen, bei dem ich mich entschuldigen muss, und natürlich auch den letzte Weg, den wir alle einmal gehen müssen.

Der Beamte hätte einen Untergebenen zu Jesus schicken können, mit den gleichen Worten, und doch wäre nichts von dem passiert, was passiert ist.
Die wirklich entscheidenden Wege unseres Lebens müssen wir selber gehen, auf die Gefahr hin, uns lächerlich zu machen, auf die Gefahr hin, vom rechten Weg abzukommen.
Die Situation seines Sohnes lässt den Beamten losgehen, aus sich heraus gehen, auf Jesus zugehen. Diesen Weg, das weiß er, kann ihm niemand abnehmen.
Auch den Weg des Glauben kann niemand anderes für uns gehen, so sehr Eltern, Paten und Gemeinde uns dabei begleiten sollten: Gehen müssen wir selbst.
Der zweite Schritt heißt „Bitte sagen“
Der königliche Beamte war mit großer Macht ausgestattet, war es gewohnt, Befehle und Anordnungen zu geben. Stattdessen jetzt nur „bitte“ sagen zu können, war sicher eine große Überwindung für ihn. Aber er tut es und bittet den Wanderprediger um Hilfe, ja, er fleht ihn an: „Herr, bitte komm!“
Auch zu Gott brauchen wir nur „bitte“ zu sagen: Bitte begleite mich auf meinem Weg, bitte vergib mir meine Schuld, bitte lass mein Leben nicht scheitern…
Der dritte Schritt heißt „Vertrauen wagen“
Jesus ist für den königlichen Beamten der letzte Ausweg. Von seinem Weinwunder hatte er schon einmal gehört und von seinem einfühlsamen Umgang mit den Menschen, mehr nicht. Und doch wagt er den Schritt auf Jesus zu, obwohl er sich in den Augen der Menschen damit schwach und angreifbar machte. Stattdessen findet er bei Jesus Gehör, ja, er wird später von Jesus sogar als Glaubensbeispiel hingestellt.
Sich einzulassen auf einen Menschen, ihm zu vertrauen, ist ein Wagnis, aber nur so kann eine echte Beziehung entstehen. Das gilt im Übrigen auch für unser Verhältnis zu Gott…
Wie es mit dem königlichen Beamten und seinem Sohn, seiner Familie weiterging, berichtet Johannes nicht. Es ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, wie es mit uns weitergeht. Glauben kann gelingen, auch in der heutigen wenig religiösen Zeit, denn: Wunder gibt es immer wieder…
Ich wünsch Ihnen eine „wunderbare“ Woche.
Amen.
2. Sonntag nach Epiphanias 2024
Text: Hebräer 12, 12-17 i. A.
Liebe Leserinnen und Leser,
ein Mann kämpft sich verzweifelt durch Schnee und Eis, der Orkan brüllt, der Mann ist total erschöpft, er kann nicht mehr, stolpert nur noch voran und fällt schließlich nieder. Er möchte am liebsten liegen bleiben, aufgeben, nicht mehr weiter laufen und kämpfen müssen. Aber das würde seinen sicheren Tod bedeuten. Aber dann gibt es doch irgend etwas, das ihn schließlich aufstehen und weiter stolpern lässt, und schließlich wird er gerettet…
Diese „filmreife Szene“ fiel mir beim Lesen des heutigen Predigttextes ein. Er steht im 12. Kapitel des Hebräerbriefes. Der Autor des Briefes ermutigt seine Leserinnen und Leser mit folgenden Worten, nicht stehen zu bleiben, sondern sich aufzuraffen:
Stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie und lenkt eure Schritte entschlossen in die richtige Richtung, denn die lahm gewordenen Füße dürfen nicht auch noch vom Weg abkommen.
Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Gebt aufeinander acht, dass niemand die Gnade Gottes verscherzt.
Achtet darauf, dass keiner mit heiligen Dingen so leichtfertig umgeht wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Als er später den Segen seines Vaters haben wollte, fand er kein Möglichkeit mehr, das Geschehen rückgängig zu machen.
Die Überschrift des Textes könnte lauten: „Unterwegs sein…“, und der Autor zeigt Gründe auf, weshalb es für die christliche Gemeinde gut und sinnvoll ist, nicht im Jetzt zu verharren oder nur nach hinten zu sehen, sondern loszugehen.
Losgehen, weil wir das Ziel kennen
Der Autor des Hebräerbriefes vergleicht die christliche Gemeinde in seinem Brief immer wieder mit dem Volk Israel auf der Wanderschaft durch die Wüste. Gott, der in einer Wolken- bzw. Feuersäule vor dem Volk herzog, diente dem Volk damals als direkte Orientierung. Das Volk kam schließlich an sein Ziel, auch wenn ihm das zeitweise sehr fraglich erschien und obwohl es sehr viel länger dauerte, als erwartet.
Auch als Christen, als Gemeinde Jesu Christi, sind wir zu Beginn des Jahres in der Situation, nicht recht zu wissen, wie s weitergehen soll mit unserer Welt, unserem Klima, unseren Kirchen, mit den Fragen der Energie und des Friedens, den Protesten von allen Seiten… a möchte man vielleicht auch am liebsten -im Bild gesprochen- liegenbleiben. Das aber, würde uns der Autor des Hebräerbriefes vermutlich sagen, solltet ihr auf keinen Fall tun, schließlich habt ihr als ChristInnen doch ein Ziel vor Augen!
Auf jedem Weg ist die Phase des Aufbruchs ist die entscheidende Phase: Was nutzen mir die schönsten Gedanken über das Ziel, wenn ich meine Beine nicht aus dem Bett bekomme und endlich losgehe?. Die Kirche gleicht manchmal jenen Menschen, die vor lauter Liegen schon lahme Füße bekommen haben. Der Schreiber des Hebräerbriefes gibt einen Rat, wie solche Schäden behoben werden können: Setzt euch einfach in Bewegung, rät er, tut etwas, rafft euch auf!
Unsere Gemeinden strotzen selten vor Lebensfülle, im Gegenteil, sie liegen oftmals mehr oder weniger danieder. Mancher möchte resignieren und sagen: Es ist ja doch alles egal! Der Schreiber des Hebräerbriefes hält das für den völlig falschen Weg: Rafft euch auf, denn wer rastet, der rostet. Das trifft nicht nur für Menschen und Autos zu, sondern auch für die christliche Gemeinde. Wichtig ist das Ziel zu kennen und ihm näher zu kommen, wenn auch nur stückweise… Mit diesem Schwung können wir auch die Etappe des neuen Jahres durchstehen- mit Gottes Hilfe!
Losgehen, weil wir gemeinsam unterwegs sind
Ein Vater hatte sieben Söhne, die öfter miteinander uneins waren. Über dem Zanken und Streiten versäumten sie die Arbeit. Einige Leute hatten im Sinn, diese Uneinigkeit zu benutzen, um die Söhne nach dem Tod ihres Vaters um ihr Erbteil zu bringen. Da ließ der Alte die sieben Söhne zusammenkommen, legte ihnen sieben Stäbe vor, die fest zusammengebunden waren, und sagte: „Dem von euch, der dieses Bündel Stäbe zerbricht, zahle ich hundert Taler.“
Einer nach dem andern strengte alle seine Kräfte an, und jeder sagte nach langem vergeblichem Bemühen: „Es ist gar nicht möglich!“
„Und doch“, sagte der Vater, „ist nichts leichter als das!“ Er löste das Bündel auf und zerbrach einen Stab nach dem andern. „So ist es natürlich leicht, so könnte es sogar ein kleines Kind…“ riefen die Söhne, aber der Vater sagte: „Wie es mit diesen Stäben ist, so ist es mit euch: Solange ihr zusammenhaltet, werdet ihr bestehen, und niemand wird euch überwältigen können. Wird aber das Band der Eintracht aufgelöst, so geht es euch wie den Stäben, die hier zerbrochen herumliegen.“
In den westlichen Kirchen ist das Gemeinschaftsempfinden nicht besonders ausgeprägt. Heißt es nicht in der Bibel, man solle im stillen Kämmerlein beten? Wozu braucht man da die Gemeinschaft mit Anderen?
Wichtig bei einer Wanderung ist es, dass der Einzelne den Anschluss nicht verpasst, denn sonst gerät er möglicherweise in Gefahr. So ist es auch für die Gemeinde Jesu Christi wichtig, zusammenzuhalten und zusammenzubleiben, damit niemand zurückbleibt, sich absondert oder den Anschluss verliert. „Gebt aufeinander acht…“, schreibt der Autor des Hebräerbriefes.
Gemeinschaft ist wichtig, weil Andere mir mit ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten eine Hilfe sein können. Es ist oft schon eine Hilfe, wenn ich merke, dass andere ChristInnen die gleichen Probleme haben wie ich. Wenn sie dann auch noch darüber berichten können, wie sie diese Schwierigkeiten überwunden haben, umso besser.
Manche Dinge gelingen in der Gemeinschaft auch einfach besser, nicht nur die Erbsensuppe aus dem großen Topf. Und es ist auch etwas anderes, einen Choral alleine zuhause zu singen, oder ihn mit vielen anderen Menschen zusammen zu singen, auf die Stimmen der Anderen zu hören oder gestärkt zu werden durch das gemeinsam gesprochene Glaubensbekenntnis.
Losgehen und auf das Wesentliche achten…
Der Schreiber des Hebräerbriefes erinnert seine LeserInnen an die Zwillinge Jakob und Esau: Esau besaß das Erstgeburtsrecht, aber es war für ihn unwichtig geworden, er sah keinen unmittelbaren Nutzen darin, es zu besitzen. Erst später, nach dem Tod des Vaters, merkte er, was ihm dadurch entgangen war.

Ähnlich denken nicht wenige ChristInnen: Wir sind ja Kinder Gottes, das reicht, warum sich einsetzen für die Gemeinschaft? Und warum einen Gottesdienst besuchen oder das Kirchenjahr in unser Leben mit einzubeziehen? Manche Menschen halten in dieser Stimmung den finanziellen Vorteil, den ein Kirchenaustritt mit sich bringt, für ein Argument, sich von der Kirche zu trennen.
Glanz anders gestrickt als Esau ist sein Bruder Jakob, der zwar auf der einen Seite ein Schlitzohr war, dem aber der Segen des Vaters ausgesprochen wichtig war. Jakob, das Schlitzohr, hatte ein Gefühl für das Heilige, und dafür, dass es mehr gab als allein äußeren Reichtum…
Es entgeht uns Entscheidendes, wenn wir auf die Gemeinschaft im Glauben verzichten, aber es entgeht uns ebenso Entscheidendes, wenn wir die geistliche Seite unseres Lebens vernachlässigen oder sie verkümmern lassen. Nehmen wir als Beispiel die Feier des Abendmahls oder Eucharistie: Wenn Gott mir meine Schuld vergibt, wenn ich seine Gegenwart erlebe, dann kann das nicht ohne Auswirkungen bleiben auf mein Verhältnis zu den anderen am Tisch des Herrn versammelten Menschen, es verändert mich, ist eine Wegzehrung auf meinem Lebenspfad. Und so ist es mit vielen geistlichen Gaben, die heute ein Schattendasein führen, die Bibel oder die Gottesdienste, um nur zwei Beispiel zu nennen.
Vielleicht ist das neue Jahr ja eine Gelegenheit darüber nachzudenken, was mit entgeht, wenn ich auf diese guten Gaben Gottes verzichte, oder sich darüber zu freuen, dass sie mein Leben schon jetzt bereichern.
Amen.
Epiphanias
Text: Matthäus 2, 1-12
Liebe Leserinnen und Leser,
manche Besitzerinnen und Besitzer von Krippen lassen ihre Figuren je nach Kirchenjahreszeit „wandern“: Das Jesuskind kommt erst am Heiligen Abend in die Krippe und die Weisen aus dem Morgenland noch viel später. Entweder sind sie am Weihnachtstag noch gar nicht zu sehen, oder, wenn man eine entsprechend große Krippe und Landschaft drumherum hat, sieht man sie jeden Tag ein par Zentimeter näher zur Krippe vorrücken. Wer so der biblischen Erzählung folgt, bei dem sind heute, am Festtag Epiphanias, die Weisen an ihrem Ziel angekommen. 
Ich finde, dass dies ein sehr schöner Brauch ist, durch den die Weihnachtsgeschichte noch einmal vor unseren Augen lebendig wird, denn mit mit dem heutigen Festtag „Epiphanias“ geht sie offiziell zu Ende.
Epiphanias bedeutet dem Wort nach so viel wie „Erscheinung“ und ist das älteste Fest der Kirche, das kalendarisch festgelegt wurde. Schon um 300 n. Chr. wurde es im Osten gefeiert, und zwar mit vielen unterschiedlichen Inhalten, als Fest der Geburt Jesu, der Taufe Jesu, der Erinnerung an das Weinwunder zu Kana und der Verklärung Jesu.
In der Westkirche dagegen wurde der inhaltliche Schwerpunkt immer stärker auf die Geschichte von den „Weisen aus dem Morgenland“ gelegt. Denen war in der Tat etwas erschienen, nämlich der Stern, dem sie bis zur Krippe gefolgt waren. Ihre Geschichte, die wir eben innerhalb der Weihnachtshistorie gehört haben, soll uns heute Abend beschäftigen.
Zuvor aber werfen wir einen Blick auf die beiden anderen Personen, die in der Erzählung des Evangelisten Matthäus vorkommen.
Da ist der scheinbar so mächtige König Herodes
Er wurde „der Große“ genannt und war von 37 – 4 v. Chr. römischer Vasallenkönig in Palästina. Er war ein skrupelloser und hinterlistiger Herrscher. Nachdem er mit römischer Hilfe die Stadt Jerusalem gewaltsam eingenommen hatte, machte er auf Bitten seiner Frau seinen 16-jährigen Schwager zum Hohepriester, ließ ihn jedoch nach dessen erstem Auftritt von seinen Dienern ertränken. Mitbewerber um das Königsamt wurden auf seinen Befehl hin ermordet, später u. a. seine Ehefrau und drei seiner Söhne. Bei den Juden war er sein Leben lang verhasst.
Im Matthäus-Evangelium spürt man zwischen den Zeilen sehr deutlich seine Angst vor dem Verlust der Macht: Die Geburt eines möglichen Konkurrenten versetzte ihn in großes Erschrecken. Jede Macht ist dem Menschen nur auf Zeit gegeben. Das sind etwa die Spielregeln der Demokratie. Diktatoren wollen das oft nicht wahrhaben, kleben an der Macht oder wollen ein „tausendjähriges Reich“ erschaffen. Herodes konnte durch Mord, Betrug und Lüge lange an der Macht bleiben, und so wollte er es auch weiterhin machen: Auf keinen Fall würde er den Neugeborenen angebetet haben, sondern ihn skrupellos töten lassen.
Der nach außen hin so mächtige Herodes ist bei näherer Betrachtung ein bedauernswerter Mensch, vermutlich ohne wirkliche Freunde, voller Angst vor dem Verlust seiner Macht, die er nur mit Betrug und Gewalt erhalten konnte. Sein Ende aber war nahe, denn der Tod macht auch bei Tyrannen keine Ausnahme. Herodes starb wenige Jahre nach der Geburt Jesu und die Heilige Familie konnte wieder heimkehren. Der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann sagte einmal in Bezug auf das so genannte „Dritte Reich“:, aber auch für die Geschichte um Herodes passend: „Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt!“
Und dann ist da das scheinbar schwache Kind
Die Weisen aus dem Morgenland suchten einen neuen König. Als sie das Jesus-Kind fanden, entsprach es vermutlich kaum ihren Erwartungen: kein Luxus, kein Hofstaat, kein Palast, ganz im Gegenteil, ein Kleinkind in einer ärmlichen Hütte, in eine Futterkrippe gelegt, ohne Leibwächter, Berater oder Minister. Und doch spräche von den Weisen und auch von Herodes heute kaum noch jemand, hätten sie nicht eine Rolle im Leben des göttlichen Kindes gespielt.
Auch der erwachsene Jesus war nach allgemeinem Sprachgebrauch nicht „mächtig“ zu nennen, und dennoch hat er viele Menschen fasziniert:
Seine Waffe: Das Vertrauen zu Gott;
Sein Reichtum: In jedem Menschen ein geliebtes Geschöpf seines himmlischen Vaters zu sehen;
Seine Stärke: Jeden Menschen vorbehaltlos anzuhören und anzunehmen;
Seine Ruhe: Das Wissen, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist;
Seine Basis: Das Gesetz zu achten und ein neues Gebot zu erteilen, nämlich Gott und den Nächsten zu lieben;
Jesus hat sich nie als König gesehen oder beschrieben, im Gegenteil: Als man ihn einmal nach einer Wundertat zum König machen wollte, entzog er sich den Massen. Aber sowohl am Anfang als auch am Ende seines Lebens, an der Krippe und am Kreuz, wird er als König bezeichnet: Jesus von Nazareth, König der Juden.
In Schwachheit und Hilflosigkeit kommt Gott auf die Erde, und doch ist seine Macht und Kraft so groß, dass sie selbst der Tod nicht überwinden kann.
Und dann sind da endlich die so genannten Weisen

Oft bezeichnen wir sie auch als die „Heiligen Drei Könige“. In unserer früheren Heimat sind um den heutigen Tag herum die so genannten Sternsänger unterwegs, Kinder, die als „die Heilgen drei Könige“ verkleidet von Haus zu Haus gehen, Geld für eine guten Zweck sammeln und die Buchstaben C, B und M an die Tür schreiben, was für Caspar, Balthasar und Melchior steht oder als Abkürzung für „Gott segne dieses Haus“. Die Buchstaben bleiben in der Regel das ganze Jahr über an der Tür und erinnern so an Epiphanias und daran, wie gut Gottes Segen für uns ist…
Dass es damals drei Personen waren, steht übrigens gar nicht in der Bibel. Und sicher waren es auch keine wirklichen Könige, sondern nur Sterndeuter, vermutlich persische Priester. Aber weil von drei Geschenken, nämlich von Gold, Weihrauch und Myrrhe berichtet wird, ist man bald auch von drei Schenkenden ausgegangen. Und weil die Geschenke so kostbar waren, wurden aus den Weisen bald die „Könige“.
Nur der Stern führt die Weisen, nicht fromme Schriften oder Bücher. Aber sie kommen an und vor allem: Sie beten an. Zu Beginn des Lebens Jesu geschieht also schon einmal das, was das Ziel seines Lebens sein sollte: Menschen erkennen in ihm den Gesandten Gottes, den König der Juden.
Die Weisen sind für mich ein Symbol des Suchens und des Findens. Drei Weise, wenn auch die Zahl nicht ausdrücklich erwähnt wird, drei Weise sind das Symbol für die ganze Menschheit geworden, denn „drei“ bedeutete damals Vollkommenheit. Oft werden die Weisen dargestellt als Jüngling, Mann und Greis oder weiß, braun und schwarz, die drei damals bekannten Erdteile symbolisierend.
Mit dem Auftreten der drei Weisen, die ja keine Israeliten, keine Juden waren, wird schon von Anfang an deutlich, dass die gute Nachricht von Jesus und seinem himmlischen Vater nicht nur für das Volk Israel bestimmt ist, sondern für alle Menschen. Die von außen kommenden fremden Priester waren damals dem Kind näher als viele Menschen in Bethlehem oder Jerusalem.
Auch wir meinen oftmals, dem Weihnachtsgeschehen ganz nahe zu sein, und sind doch durch große Familienfeiern, Glühwein-geschwängerte Weihnachtsmärkte usw. abgelenkt vom wirklichen Weihnachtsgeschehen.
So kommen wir zwangsläufig zu der Frage, die wir uns bei biblische Erzählungen eigentlich immer stellen sollten, wenn wir sie nicht einfach nur an uns „vorbeirauschen“ lassen wollen: Wo kommen wir in dieser Geschichte vor, wo stehen wir?
Stehen wir bei Herodes und seinen Beratern, mit Angst vor Neuem und unfähig, Gottes Gegenwart zu erkennen? Das glaube ich von niemandem, der heute hier ist.

Stehen wir stattdessen anbetend an der Krippe des Jesuskindes, so wie wir es vor dieser Predigt gemeinsam gesungen haben? Wohl dem, der das von sich sagen kann.
Oder sind wir vielleicht mit den Weisen unterwegs, suchend und ein wenig wissend zugleich, von weit her kommend und dem Kind zugleich ganz nahe, geleitet von Gottes wundersamen Stern?
Ich glaube, es wäre schon viel gewonnen, wenn wir mit den Weisen auf dem Weg wären zum göttlichen Kind. Die Suche der Weisen war ja kein zielloses Umherstreifen, vielmehr wies ihnen ein Stern den Weg, ein Stern, hinter dem niemand anderes als Gott selber stand. Damit ist der Weg der Weisen ein Bild für die Führung Gottes in unserem Leben. Gehen müssen wir freilich selber, aber es ist gut zu wissen, wohin wir unterwegs sind.
Als die Weisen das Kind endlich gefunden hatten, blieben sie nicht im Stall, was absurd gewesen wäre, denn das göttliche Kind selbst musste ja schon bald weiterziehen. Vielmehr suchten sie einen neuen Weg, um zurück in ihre Heimat zu gelangen. Vielleicht ist das auch ein Bild für unsere Kirchen, unsere Gemeinden: Vieles wird sich in den nächsten Jahrzehnten ändern, weiter Finanzen, weniger Mitglieder, weniger Pfarrerinnen und Pfarrer. Resignation ist nicht angebracht, aber neue Wege werden wir suchen und gehen müssen.
Wer oder was wird die Weisen auf dem Rückweg geleitet haben? Jedenfalls dürfte es wieder ein „guter Stern“ gewesen sein, denn die teuflischen Pläne des Herodes werden durch ihren Umweg unterlaufen.

So dürfen auch wir im Glauben immer wieder zu neuen Ufern aufbrechen, wenn wir dabei nur eines nicht vergessen, nämlich uns vom hellen Stern der Liebe Gottes leiten zu lassen. Amen.
Predigten 2023
Altjahrsabend 2023
Text: Prediger 3, 1-13 i. A.
Liebe Leserinnen und Leser,
das Buch „Kohelet“ gehört kaum zu den bekannteren Büchern der Heiligen Schrift. Luther nannte das Buch „Der Prediger Salomo“, weil manches darauf hindeutet, dass Ideen und Vorstellungen des Königs Salomo darin zum Ausdruck kommen.
Das Buch gehört zur biblischen Weisheitsliteratur, nimmt darin allerdings eine besondere Stellung ein. Die herkömmliche alt-testamentliche Weisheit war der Überzeugung, dass es am Verhalten des Menschen liege, ob er im Leben Glück und Erfolg habe. Der Autor, wir nennen ihn den „Prediger“, begegnet dieser Sichtweise mit einer gehörigen Portion Skepsis: Allzu oft widerlege die Erfahrung diese Annahme, und ein dauerhaftes Glück sei noch keinem Menschen beschieden gewesen. Spätestens der Tod mache alles Glück zunichte.
In unserem heutigen Predigttext beschreibt er zunächst das menschliche Leben. Diese Passage ist vermutlich die bekanntesten im ganzen Buch:
Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde:
Geboren werden hat seine Zeit, Sterben hat seine Zeit.
Pflanzen hat seine Zeit, und Ausreißen hat seine Zeit.
Töten hat seine Zeit, und Heilen hat seine Zeit.
Abbrechen hat seine Zeit, Bauen hat seine Zeit.
Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit.
Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit.
Umarmen hat seine Zeit, sich Meiden hat seine Zeit.
Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit.
Behalten hat seine Zeit, Wegwerfen hat seine Zeit.
Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit.
Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit.
Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit…
Alles kommt vor im Leben, heute oder morgen, wenn es uns gefällt oder wenn nicht. Und kein Leben besteht nur aus der einen oder der anderen Kategorie von Lebensvollzügen. Der Wechsel tut uns in der Regel gut: Immer nur Wein zu trinken und Kaviar zu essen wäre auf Dauer eine Qual, immer nur Ferien zu haben, wäre für die Meisten von uns nicht auszuhalten. Eva von Tiele-Winckler, Gründerin des Diakonissenhauses „Friedenshort“ dichtete:
Immer nur Sonnenschein, wäre zu hell,
immer nur weitergeh’n, ginge zu schnell.
Regen und Wolkenguß muß einmal sein,
willst du am Himmelsblau doppelt dich freu’n!
Der Wechsel gehört zu unserem Leben dazu wie der Wechsel der Jahreszeiten, der Wechsel von Tag und Nacht oder von Schlafen und Wachsein, einatmen und ausatmen, Jahresende und Jahresbeginn.
Die Ostband „Puhdys“ machte aus unserem Predigttext im Jahr 1974 einen Song mit folgenden Worten:
Jegliches hat seine Zeit,
Steine sammeln, Steine zerstreu’n,
Bäume pflanzen, Bäume abhau’n,
Leben und sterben und Streit.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt,
Sagt die Welt, dass er zu früh geht.
Wenn ein Mensch lange Zeit lebt,
Sagt die Welt, es ist Zeit, daß er geht

Der Satz „Alles hat seine Zeit…“ oder „Jegliches hat seine Zeit…“ will uns dazu ermahnen, mit unserer Zeit sorgsam umzugehen, denn sie ist das Kostbarste, was wir haben. Wir messen sie nicht nur in Tagen und Stunden, sondern auch in Minuten und Sekunden, Sportlerinnen und Sportler gar in tausendstel Sekunden.
In dem Song „Seasons of love“ aus dem Jahr 1996 wird die Frage gestellt, wie man Zeit messen kann, besser: woran man sie messen kann. Ich kann einfach die Minuten zusammenzählen und kommt dann auf 525.600 Minuten. Ein Zungenbrecher im englischen… Aber kann man so rechnen?
Man sollte stattdessen lieben rechnen in schönen Minuten, die man erlebt hat, in Tassen von Kaffe, in Augenblicke der Liebe….
Es ist jedenfalls ein kostbares Geschenk, wenn ein Mensch einem anderen sagt: „Ich nehme mir Zeit für dich.“, denn Zeit steht uns eben nur einmal zur Verfügung. Und niemand weiß wirklich, was die Zeit bringen wird. Genau das ist auch der Inhalt des Liedes: „Only time“, in dem es heißt:
Wer kann sagen, wohin Deine Straße Dich führt
und was der Tag Dir noch bringen wird?
Und wer kann sagen, ob Deine Liebe so wächst,
wie Dein Herz es sich wünscht?
Only time, nur die Zeit.
Wer kann sagen, warum Dein Herz seufzt,
wenn Deine Liebe sich verflüchtigt?
Und wer sagen kann, warum Dein Herz schreit,
wenn Deine Liebe ruht?
Wer kann sagen, wann sich Eure Wege kreuzen
und die Liebe Dein Herz erfüllen kann?
Ja, wer kann sagen, wohin Deine Straße Dich führt
und was der Tag Dir noch bringen wird?
Only time!
Wer kann schon sagen, was das Leben bringt? Das galt auch für den Song selbst, den die irische Sängerin Enya im Jahr 2000 herausbrachte. Er war wegen seiner langsamen und ruhigen Art nur mäßig erfolgreich. Dann kam das Jahr 2001 mit den Terroranschlägen in New York und Washington, die die Welt erschütterten und veränderten. Ein Journalist stellte damals in einem Video erschütternde Bilder und Tondokumente zusammen und hinterlegte das Ganze mit dem Song „Only time“. Sofort übernahmen das beinahe alle amerikanischen Sender, später Sender in der ganzen Welt. Der Song wurde so zum Ohrwurm und zum weltweiten Super-Hit. Only Time erreichte am 1. Oktober 2001 die Chartspitze in Deutschland, an der es sich sechs Wochen hielt. Das dazugehörige Video hatte 190 Millionen Aufrufe. Die Einnahmen aus dem Song spendet Enya übrigens den Hinterbliebenen der 9/11 Opfer.
Kommen wir noch einmal zurück zum Predigttext: Die Beschreibung des Lebens durch den Prediger wäre nicht wirklich bemerkenswert, erst recht wäre es keine Grundlage für ein Predigt, wenn es bei den gehörten Passagen bliebe. Aber nun kommt Gott doch noch ins Spiel, anders als die Pudhies oder Enya. Der Prediger schreibt:
Ich sah, dass Gott alles schön gemacht hatte zu seiner Zeit.
Dieser Satz nimmt Bezug auf die Schöpfungsgeschichte, in der es nach Erschaffung der Welt heißt: „Und siehe, es war sehr gut!“ Wenn wir die Überzeugung teilen, dass Gott in irgendeiner Form Schöpfer der Welt ist, bleibt dennoch die Frage, woher all das Negative und Schreckliche in der Welt kommt, damals wie heute. Ist es das Böse, das in uns steckt? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube daran, dass Gott uns selbst in den dunkelsten Momenten unseres Lebens nicht alleine lassen wird. So kann selbst eine Krankheit, die sicher nicht von Gott gewollt ist, den Menschen zur Erkenntnis und zu einer Intensivierung seines Lebens führen.
Wenn wir die Überzeugung teilen, dass Gott Schöpfer der Welt sei und dass er sie sehr gut gemacht habe, dann sollten wir allerdings in der Zeit, die uns gegeben ist, alles daransetzen, diese schöne Welt Gottes für unsere Nachkommen zum bewahren…
Gegen Ende kommt noch einmal ein ganz neuer Aspekt in unseren Text hinein. Der Prediger schreibt:
Ich sah, dass Gott den Menschen die Ewigkeit in ihr Herz gelegt hatte.
Es unterscheidet den Menschen von den Tieren, dass wir um unsere Vergangenheit und unsere Zukunft wissen. Hier aber geht es um eine besondere Zukunft, die nämlich, die wir bei Gott haben.
Christinnen und Christen haben eine Hoffnung über den Tod hinaus, die sich durch das ganze Neue Testament hindurchzieht. Aber auch ein österreichischer Sänger tut dies, einer der sonst nicht für ruhige Töne bekannt ist. Andreas Gabalier verarbeitete den Suizid seines Vaters und seiner jüngeren Schwester in einem Lied, das 94 Millionen Aufrufe hatte und dabei über 330 000 Likes. Es wird heute noch häufig bei Trauerfeiern gespielt und auf hochdeutsch übersetzt heißt es darin:
Uns allen ist die Zeit zu gehen bestimmt,
wie ein Blatt, getragen vom Wind,
geht’s zum Ursprung zurück als Kind.
Wenn das Blut in deinen Adern gefriert,
weil dein Herz aufhört zu schlagen
und du zu den Engeln fliegst,
dann hab keine Angst und lass dich einfach tragen,
denn es gibt was nach dem Leben, du wirst schon sehen
Einmal sehen wir uns wieder…
Es soll die Hoffnung auf ein Wiedersehen
Mir die Kraft in meinen Herzschlag legen,
um weiterzuleben…
Der Mensch ahnt etwas von seiner Zukunft bei Gott, spürt, dass er ein Gegenüber hat, das ihn auch an der Grenze des Lebens, ja auch an seinem Ende, nicht im Stich lässt. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Gott, so wird Paulus einige Jahrhunderte später schreiben, so sind wir die ärmsten aller Menschen. Aber sie geht eben über dieses Leben hinaus, daran glauben wir.
Wenn man diese Gewissheit und Zuversicht hat, daneben zu essen und zu trinken, ein Dach über dem Kopf und ein paar Menschen, die einem wohl-gesonnen sind, dann braucht man eigentlich nicht viel mehr für ein sinnvolles und sinn-erfülltes Leben. Eines aber gibt der Prediger seinen Leserinnen und Lesern noch mit auf den Weg:
Ergründen allerdings können die Menschen Gottes Werk nicht,weder ihren Anfang, noch ihr Ende.
Gott ist in der Tat nicht zu ergründen, aber zu erfahren. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung im Jahr 2024.
Amen.
Heiligabend und Weihnachten 2023
Text: Lukas 2, 10-11
Liebe Leserinnen und Leser,
im Gottesdienst am Heiligen Abend in der schönen kleinen Kirche von Eckwarden geht es um eine Geschichte, in der die Tiere des Waldes und des Feldes sich gegenseitig erzählen, was Weihnachten für sie bedeutet:
Der Fuchs sagte:
Fuchs: Also ich finde, eine Gans ist das Wichtigste an Weihnachten. Schön knusprig muss sie sein. In der Soße nicht zu viel Fett. Auf die Klöße könnte ich im Grunde verzichten. Aber ohne Gans ist für mich kein Weihnachten.
Darauf erwiderte das Reh:
Reh: Also ich brauche für mein Weihnachten einen Baum. Wie der geschmückt ist, das ist mir völlig egal, ich brauch nur die Rinde. Und natürlich ist es nicht schlecht, wenn mir jemand eine Futterkrippe neben den Baum stellt, damit ich etwas zum Beißen habe, wenn es so kalt ist.
Bei dem Gedanken ans Essen lief dem Bären das Wasser im Mund zusammen:
Bär: Wenn ich zu Weihnachten einen leckeren Stollen bekomme, dann bin ich wunschlos glücklich. Und wenn ich noch ein Glas Honig dazu bekäme, das wäre einfach himmlisch, das wäre Weihnachten!
Die Eule drehte ihren Kopf zum Bären hin und meinte:
Eule: Also ich brauche schummriges Licht an Weihnachten. Es darf auf keine Fall zu hell sein. Ein paar Kerzen reichen mir für eine gute Stimmung.
Da schaltete sich der Pinguin ein:
Pinguin: Also Weihnachten ohne Schnee, das ist für mich nichts. Ich finde Weihnachten am schönsten, wenn es draußen schneit und die Welt in ein herrlich glitzerndes Weiß getaucht ist.
Elster: Glitzern? Ja, glitzern ist schön!
sagte die Elster.
Elster: Für mich ist Weihnachten, wenn ich eine Perlenkette oder einen Goldring kriege. Wenn ich keine Geschenke kriege, nehme ich mir eben ein paar Schmuckstücke von den Menschen, die haben ja so viel davon.
Der sonst so stille und etwas schläfrige Dachs war bei dem Wort „Schnee“ munter geworden:
Dachs: Lange pennen. Das ist es. Wenn wenn es draußen schneit, so richtig lange pennen. Dann ist es Weihnachten….
Eine Geschichte, ganz einfach, für jeden zu versehen, und das sollte ja zu Weihnachten auch so sein…
Denn das wird für jeden klar, ob groß oder klein, mit den Tieren sind wir selbst gemeint, niemand sonst. Denn auch bei uns bedeutet Weihnachten eigentlich für jeden von uns etwas anderes.
 Für viel sind tatsächlich die Geschenke das Wichtigste. Je älter die Kinder sind, um so teurer und anspruchsvoller werden die Wünsche. Und auch bei den Erwachsenen sind teure Geschenke keine Ausnahme. Vielleicht gibt es in diesem Jahr in dieser Hinsicht manche Enttäuschung, weil doch viele Menschen angesichts steigender Preise und wirtschaftlicher Unsicherheit den Gürtel enger schnallen müssen.
Für viel sind tatsächlich die Geschenke das Wichtigste. Je älter die Kinder sind, um so teurer und anspruchsvoller werden die Wünsche. Und auch bei den Erwachsenen sind teure Geschenke keine Ausnahme. Vielleicht gibt es in diesem Jahr in dieser Hinsicht manche Enttäuschung, weil doch viele Menschen angesichts steigender Preise und wirtschaftlicher Unsicherheit den Gürtel enger schnallen müssen.
Für andere Menschen gehört ein gutes und stilvolles Essen am Heiligen Abend unbedingt dazu. In einer Untersuchung heißt es: „Das gemeinsame Essen stellt den Mittelpunkt des Weihnachtsfestes dar, weshalb die meisten keine Zeit und Mühen scheuen, um die perfekte Mahlzeit vorzubereiten… Beim Kochen des Weihnachtsessens nehmen sich 34% der Menschen 2-4 Stunden Zeit, während 31% sogar ganze 4-6 Stunden investieren.“ Natürlich darf meist auch ein guter Wein oder eine Flasche Champagner nicht fehlen.
Für wieder Andere ist die Familienzusammenkunft an Weihnachten das Wichtigste. Auch dagegen ist nichts zu sagen. Schön, wenn der Familienzusammenhalt gefestigt wird, was allerdings nicht immer gelingt. Die Kehrseite der Medaille ist, dass diejenigen, die keine Familie haben, sich an den Weihnachtstagen oft belastend einem fühlen

Jeder und jede verbindet mit Weihnachten etwas anderes. „Weiße Weihnachten“ können wir uns wohl abschminken bei prognostizierten Temperaturen von 13 Grad. Ausschlafen, das müsste gehen, ausser für diejenigen, die zu Weihnachten für uns anderen arbeiten müssen und die wir auch nicht vergessen sollten: Polizei, Ärzte und Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger, Feuerwehr, Landwirte usw. Und die Pastoren natürlich…
Wünsche gibt es aber auch ganz anderen Art, wovon viele unerfüllt bleiben werden: Der Wunsch nach Frieden in der Welt, nach Harmonie in der Familie, nach Gerechtigkeit, nach dem Sieg über Hunger und Krankheiten in der Welt und der Wunsch, dass unsere Erde, die Gott einst so gut gemacht hatte, auch für unsere Kinder, Enkel und Urenkel noch lebenswert sei.
Alle diese Wünsche sind verständlich und legitim. Ich wünsche Ihnen allen, dass viele Ihrer Wünsche in Erfüllung gehen. Aber was ist das Wichtigste, was ist überhaupt die Ursache, dass wir Weihnachte feiern?
Ein Kind hatte Geburtstag und lud viel dazu ein…
Ein Kind hatte Geburtstag und durfte dazu so viele Kinder einladen wie es wollte. Es kamen auch ganz viele, aber kein Kind hatte ein Geschenk dabei und die meisten waren gekommen, ohne zu wissen, dass es überhaupt um ein Geburtstagsfeier ging. Die Kinder ,die gekommen waren, spielten einfach so miteinander, aber nicht mit den Geburtstagskind. Andere saßen vor dem Fernseher und wieder andere an einer Spielkonsole oder der Puppenstube. Jeder machte irgendetwas, nur das Geburtstagskind stand fast unbeteiligt dabei und fühlte sich sehr allein… Und da war es sehr traurig….
Und so ist es heute oft auch mit Weihnachten: Wir feiern zu Weihnachten den Geburtstag Jesu, eine Geburtstagsparty könnte man sagen. Dazu sind wir alle eingeladen! Und wir müssen das Geburtstagskind noch nicht einmal beschenken, sonderte es will uns beschenken, mit seiner Liebe und seiner Freundlichkeit. Zum Zeichen dafür machen wir uns selber auch Geschenke. Aber hoffentlich vergessen wir dabei nicht wie in der Geschichte von dem kleinen Jungen das Wesentliche, die Ursache:, die Geburt Jesu!
Die Gesichte von den Tieren im Wald ist übrigens noch nicht zu Ende. Sie geht wie folgt weiter:

Pennen war das Stichwort für den Ochsen:
Ochse: Pennen, ja schon. Aber erst einmal richtig eins saufen – und dann pennen. Weihnachten kann ich mich so richtig voll laufen lassen und dann am nächsten Tag ausschlafen. Das finde ich am wichtigsten und schönsten an Weihnachten.
Da trat der Esel den Ochsen mit seinen Hinterhufen und zischte:
Esel: Du Rindviech! Das Wichtigste an Weihnachten ist doch das Christkind. Das müsstest du als Ochse doch wissen!
Der Ochse erschreckte sich furchtbar, rollte mit seinen Augen und sah den Grauen böse an. Dann aber wurde er auf einmal ganz nachdenklich und sagte kleinlaut:
Ochse: Ja, das stimmt schon. Mein Ur-ur-urgroßvater war schließlich damals mit dabei im Stall von Betlehem, dass hätte ich fast vergessen…

Ich wüsche allen Leserinnen und Lesern ein gesegnetes Weihnachtsfest mit ganz viel erfüllten Wünschen und einer tiefen Dankbarkeit für das größte Geschenk, das wir je beklommen haben und das den Hirten einst so verkündet wurde:
Fürchtet Euch nicht!
Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird;
denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids.
Amen.
3. Advent 2023
Text: Matthäus 11, 2-6
Liebe Leserinnen und Leser,
„Wir warten auf’s Christkind“ so hieß Jahrzehnte lang eine Sendung im Deutschen Fernsehen am Heiligen Abend. Es ging darum, Kindern die letzten Stunden vor der Bescherung zu verkürzen, sie abzulenken, damit ihnen das Warten nicht zu lang würde.
Um das Warten geht es auch in der heutigen Predigt: Worauf warten die Menschen im Advent?
Kleine Kinder warten tatsächlich noch auf das Christkind, jedenfalls auf schöne Geschenke, Jugendliche warten auf coole, meist elektronische Geschenke, und Erwachsene warten auf ein gelungenes Fest, auf erholsame, nicht zu stressige Festtage, und ältere Menschen warten auf den Besuch von Kindern und Enkeln, die vielleicht auch etwas Zeit für sie mitbringen…
„Warten“ hat in unserer Sprache etwas mit „erwarten“ zu tun. „Erwarten“ ist ein Warten in meistens guter, hoffnungsvoller Stimmung, mit Vorfreude auf das, was da irgendwann kommt. oder kommen sollte. Die meisten Menschen erwarten, dass es im nächsten Jahr besser wird als in diesem katastrophalen Jahr, oder zumindest, dass es nicht noch schlechter wird. Erwartungen gehören untrennbar zum menschlichen Leben dazu. Wenn ein Mensch „nichts mehr zu erwarten hat“, ist er so gut wie tot, er ist am Ende, ist erledigt.
Wer dagegen lebt, hat Erwartungen: für sich selber und für die Welt um ihn her. Man könnte fast sagen: Wir leben, solange wir etwas Erwartungen haben.
Auch der Täufer Johannes hatte um das Jahr 30 herum Erwartungen, große Erwartungen sogar. Sein Warten war besonders anstrengend, weil er zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis saß.
Aber worauf wartete er? Etwa darauf, freizukommen? Gewiss auch, aber vor allem wartete er darauf, dass endlich das Reich Gottes kommen würde, dass endlich andere, bessere Verhältnisse eintreten würden. Es müsste jemand kommen, der im Namen Gottes das Heft in die Hand nehmen würde, für Gerechtigkeit sorgen und die römische Besatzung aus dem Land treiben würde. Dass so einer kommen würde, hatte Johannes den Menschen versprochen und später erklärt, dass Jesus dieser Retter wäre. Aber jetzt im Gefängnis war er unsicher geworden. An diesem Punkt beginnt der Predigttext, den Matthäus im 11. Kapitel seines Evangeliums mit folgenden Worten wiedergibt:
Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen: „Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?“ Jesus gab ihnen zur Antwort: „Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt.“
Die Frage, die Johannes stellt, ist für ihn keine theoretische Frage, auch keine theologische. Von der Antwort hängt für Johannes persönlich ungeheuer viel ab, sein ganzes Lebenswerk, ja überhaupt sein ganzes Leben ist infrage gestellt.
So oder ähnlich mag sich Johannes gefragt haben:
– Hatte man Leben das richtige Ziel?
– Bin ich bisher einem Phantom nachgelaufen, ist Jesus ein Scharlatan oder der versprochen Retter?
– War all mein bisheriges Tun sinnlos, meine Buß-Predigt, die Anfeindungen der Menschen, das Gefängnis, das ich dafür in Kauf genommen habe?
Alles wäre für ihn tragbar gewesen, auch seine Gefangenschaft, selbst sein naher Tod, wenn die Antwort Jesu gelautet hätte: „Ja, ich bin der, auf den du gewartet hast!“
Wäre die Antwort dagegen negativ ausgefallen, wäre das eine Katastrophe für Johannes gewesen, das Ende.
Auch heute kommen Menschen an Punkte, wo sie über ihre früheren Erwartungen nachdenken und ihr bisheriges Leben überdenken: Im persönlichen Bereich, im Beruf, in der Familie, bei Beziehungen; im politischen Bereich angesichts von Kriegen und Umweltzerstörung; im religiösen Bereich bei Fragen wie „Hält mein Glaube den Anforderungen des Lebens stand?“ „Warum lässt Gott so viel Böses in der Welt zu?“ oder: „Gibt es Gott am Ende gar nicht?“
Solche Fragen können zu einer schweren Krise führen: Habe ich im Leben auf die falsche Karte gesetzt? Habe ich meine Chancen verspielt? Was habe ich eigentlich noch zu erwarten?
Die Antwort Jesu für Johannes scheint nicht eindeutig zu sein. Auf eine klare Frage hätte man eine klare Antwort erwartet, ja oder nein. Fast könnte Johannes uns leid tun, wenn er darauf hören soll, was die Leute über Jesus erzählen und das in Verbindung bringen sollen mit einem Text aus der Bibel: „Zur Zeit des Heils werden Lahme gehen und Blinde sehen.“
Ist es heute anders? Gibt es im religiösen Bereich die eindeutigen, immer gültigen Antworten oder gibt es nicht auch für die Glaubenden hin und wieder Momente, wo Fragen und Zweifel überwiegen?
Warum aber gibt Jesus keine eindeutige Antwort? Was will er mit seiner Antwort erreichen?
Jesus ermuntert die Menschen dazu, sich sein Tun genau anzusehen. In der Tat wurden ja von Jesus damals viele Wunder berichtet. In der Medizin heißt es: „Wer heilt, hat recht.“ Gilt das nicht auch für das Handeln Jesu? Aber Wunder bewirken eben nicht immer Glauben. Vielleicht war ein so genanntes Wunder nur ein Zufall, etwas, was man aus heutiger Sicht erklären kann, oder gar eine Inszenierung. Heute können wir darüber keine wissenschaftlich begründeten Aussagen treffen. Darum ist es umso wichtiger, auf das zu hören, was Jesus sagt: „Den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet.“ Jesus ist angekommen in dieser Welt, und er ist zugleich die Zukunft dieser Welt. Diese Zukunft ist das Reich Gottes, in dem Gerechtigkeit und Liebe regieren. Dieses Reich erwarten wir, wenn wir bitten: „Dein Reich komme…“. Der dritte Bundespräsident Deutschlands, Gustav Heinemann, hat einmal gesagt: „Die Herrn dieser Welt gehen, unser Herr kommt.“

Genau das ist die Botschaft des Advents: Gott gehört die Zukunft, er kommt uns in der Person Jesu entgegen, seine Ankunft erwarten wir.
Jesus lädt uns ein, genau hinzusehen, ob sich nicht etwas tut, was auf den Anbruch des Reiches Gottes hinweist. Zugegeben fällt das sehr schwer in einer Zeit, wo Glaube und Kirche nicht sehr hoch im Kurs stehen und Gewalt und Terror die Welt in Atem halten. Aber vielleicht entdecken wir in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde oder in der Familie kleine Hoffnungspflänzchen:
Wenn man sieht, wie notleidenden Menschen vor Ort geholfen wird; wenn ein Gottesdienst uns positiv verändert; wenn ein Gespräch uns neue Erkenntnisse vermittelt; wenn Ehrlichkeit zwischen uns möglich ist; wenn es zu einer echten Besinnung im Advent kommt; wenn Christen ein Bewusstsein für den Zustand von Gottes guter Schöpfung bekommen…
Wenn wir solche kleinen Schritte sehen, kann man sich fragen: Ist hier vielleicht Gott am Werk? Und dann mehr noch: Könnte so etwas nicht auch hier und jetzt durch mich geschehen?
Am Ende des heutigen Predigttextes sagt Jesus „Glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt.“ Luther übersetzt: „Selig ist, wer sich nicht an mir ärgert.“ Selig ist also nicht der, der viel Gutes tut oder der besonders häufig fastet oder betet. Selig ist, wer entgegen allem Anschein nicht an Jesus zweifelt sondern am Glauben an Gott festhält.
Was uns dabei helfen kann?
Auf die Boten der Menschenfreundlichkeit Gottes zuschauen, allen voran auf Jesus selbst, und auf Menschen, die sich selbstlos und im Namen Jesu für ihre Nächsten einsetzen. Das Wort Gottes kann uns helfen, die gute Nachricht auch und gerade für Zweifelnde und Angefochtene und die Gemeinschaft mit anderen Christenmenschen, mit solchen die ganz fest im Glauben stehen und solchen, die ihre kritischen Fragen haben.
„Gottes Reich kommt auch ohne unser Gebet von selbst“, sagt Martin Luther in der Erklärung zum Vaterunser. Aber es wäre nicht verkehrt, wenn wir unser Leben heute schon an diesem Reich Gottes ausrichten würden und, wie Luther seine Erklärung abschließt, „danach leben (würden), hier zeitlich und dort ewiglich“. Amen.
2. Sonntag im Advent 2023
Text: Offenbarung 3, 8 – 12 i. A.
Liebe Leserinnen und Leser,
auf dem heutigen Foto zur Predigt sehen Sie ein so genanntes „Stereoskop“. Die Vorrichtung ist eigentlich recht einfach: Man schaut in einem kleinen Metallgestell durch zwei Linsen, wie bei einer Brille, auf zwei kleine Fotos, das ist schon fast alles. Das Erstaunliche dabei ist: Man sieht nicht zwei Bilder, sondern eines, und das erscheint auch noch dreidimensional. Das ist so klar und deutlich, dass man fast erschrickt und glaubt, in das Bild hinein fassen zu können.

Der Hintergrund dieses Phänomens: Die Bildchen sehen zwar gleich aus, sind es aber nicht ganz. Mit einer entsprechende Kamera, die zwei Objektive hat, wurden dazu in der gleichen Sekunde zwei fast gleiche Fotos aufgenommen. Das ist ganz ähnlich, wie bei unseren Augen, die ja auch ein Stück auseinander liegen. Die beiden entstehenden Bilder werden erst in unserem Kopf zu eine dreidimensionalen Bild zusammengesetzt. Erst so können wir Entfernungen richtig abschätzen und erkennen, was sich vorne oder was sich weiter hinten befindet.
An ein Stereoskop hat mich der heutige Predigttext erinnert. Er stammt aus der Offenbarung des Johannes. Bei Johannes handelt es sich um einen frühchristlichen Propheten, der sein Buch um das Jahr 100 herum schrieb. Im ersten Teil, aus dem auch unser heutiger Predigttext stammt, fasste Johannes seine Vorstellungen und Visionen in die Form von sieben Briefen an sieben christliche Gemeinden, die symbolisch für die gesamte Kirche standen. Johannes vermittelte der Christenheit neben der damals sehr bedrückenden eine andere, eine zweite Sichtweise, so wie ein zweites Bild im Stereoskop. Beide Sichtweisen zusammen ergeben erst ein genaues und realistisches Bild.
Den heutigen Predigttext, der an ein Gemeinde mit Namen Philadelphia gerichtet ist, schrieb Johannes im Namen Gottes, der ihm seine Gedanken eingegeben habe:
Ich weiß, wie du lebst und was du tust: Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann… Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird.
Ich komme bald. Halte, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme! Wer durchhält, den werde ich zu einem Pfeiler im Tempel Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer behalten. Auf seine Stirn werde ich den Namen Gottes schreiben und den Namen des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommen wird.
Die Perspektive des Menschen
Vor ein paar Tagen wurde ein Studie veröffentlicht, wonach nur noch 20% der deutschen Bevölkerung das christliche Gottesbild teilen. Wie genau das formuliert war, weiß ich nicht, aber das Ergebnis macht deutlich, was wir alle längst spüren und was viel von uns mich sehr traurig stimmt: Der christliche Glaube hat für viele Menschen nicht mehr die Bedeutung, die er für unsere Vorfahren hatte. Die Kirchen sind an vielen Sonntagen nahezu leer, es würden locker 20-30 mal so viele Besucherinnen und Besucher Platz haben, Menschen treten aus, es sterben außerdem mehr Menschen als getauft werden, auch zu Pfingsten und Weihnachten sind die Kirchen lange nicht mehr voll, nur am Heiligen Abend sind sind sie wirklich einmal voll. Einen Teil unserer Kirchen werden wir in absehbarer Zeit aufgeben müssen, auch andere kirchliche Gebäude, die Finanzeinnahmen gehen zurück und immer weniger Pfarrerinnen und Pfarrer stehen zur Verfügung. Und man könnte diese Aufzählung noch lange fortsetzen.
Wie wird das kirchliche Leben in 20 oder 30 Jahren wohl aussehen?
Ich hätte bei dieser Frage nicht viel Hoffnung, wenn es sich um einen Verein, eine Organisation oder eine Partei handeln würde. Auch die Gemeinde Philadelphia stand offensichtlich stellvertretend für solche Gemeinden, die unter ihrer geringen Kraft litten. So klingt es tatsächlich auch heute oft aus manchen Gemeinden:
„Was haben wir nicht in der letzten Zeit für Fehler gemacht! Es sind nicht viele Menschen zu uns gekommen, aber viele sind gegangen. Wie wenig haben wir ausgestrahlt von der Kraft und der Freude des Evangeliums. Wie selten konnten wir große Veranstaltungen auf die Beine stellen. Wie selten stand etwas von uns in der Zeitung und wie wenig Menschen haben sich bereit erklärt, sich im kirchlichen Leben zu engagieren?!“
Bei der Analyse unserer Gemeinden stellen wir in der Tat oft fest, dass es viele Bereiche gibt, in denen wir nicht oder zu wenig präsent sind. Es ist in solchen Fällen sicher richtig, an diesen Schwachstellen zu arbeiten, die Angebote zu vermehren und zu verbessern.
Aber können wir nicht zugleich die Perspektive von Johannes bzw. von Gott teilen? Könnte sie uns, als gebeutelte Kirche, wieder Mut machen?
Die Perspektive Gottes
Das Urteil Gottes über die Gemeinde Philadelphia sieht offenbar anders aus, als wir es erwartet hätten:
„Ja, ihr seid schwach und eure Kraft ist klein. Aber das ist in meinen Augen nicht ausschlaggebend. Entscheidend ist vielmehr, dass ihr mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet habt!“
Es fällt auf, dass die Gemeinde kaum kritisiert wird. Der Brief hat vielmehr stärkenden, unterstützenden Charakter. „Da ist eine Tür offen“, sagt Gott, „nicht weil ihr sie mit eurer ungeheuren Kraft öffnen konntet. Vielmehr ist die Tür durch Christus geöffnet worden. So habt ihr eine neue, aussichtsreiche Perspektive: Auch mit eurer kleinen Kraft könnt ihr meine Zeugen und Boten sein bis an Ende der Welt.“.
Die Adventszeit verschiebt unseren Blick von uns selber weg, hin zu dem, was Gott tut: Er kommt uns entgegen. Wir erfahren seine Nähe neu. Und weil es letztlich auf den ankommt der da kommt, dessen Ankunft wir erwarten, deshalb kann in den Augen Gottes Augen auch unsere kleine Kraft ausreichen,
– die „nur“ durchhält,
– die „nur“ einen Ort des Friedens schafft,
– die „nur“ aufatmen lässt, uns selbst und Andere…
Die Tröstung, Stärkung und Ermutigung der Gemeinde Philadelphia gilt auch uns! Auch uns gilt die Verheißung der offenen Tür. Und außerdem kommt Gott uns entgegen, das ist das Versprechen des Advents. Aber auch nach Weihnachten werden wir mit diesem Trost, dieser neuen Sichtweise leben dürfen: ER kommt, IHM gehört die Zukunft, und wir gehören zu IHM.
Entscheidend aus der Sicht Gottes ist also nicht, wie lang die Rubrik „Veranstaltungen“ in unserem Gemeindebrief ist. Entscheidend ist die Frage: Spielt das Wort Gottes, spielt Gott selbst in unserem Leben noch eine Rolle? Bekennen wir uns zu Gott in unserem Reden und in unserem Handeln, nicht nur am Sonntag??
Christen kennen und teilen die Perspektive Gottes, die über unserer Zeit und unser normales Vorstellungsvermögen hinausgeht. Gott sei Dank!
Die Krone des Lebens
Am Ende fordert Johannes die Christenheit auf: „Haltet, was ihr habt, damit euch niemand eure Krone nimmt!“
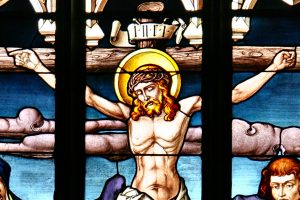
Jesus selber trug zeitlebens nur die Dornenkrone. Aber obwohl sie äußerlich betrachtet der Anfang vom Ende war, war sie doch zugleich eine Lebens- und Siegeskrone, denn der dornengekrönte Christus hat am Ende den Tod ein-für-alle-Mal überwunden!
Und eine solche Lebens- und Siegeskrone gibt es auch für uns! Vor über 70 Jahren hat einer meiner Vorgänger den Konfirmandinnen und Konfirmanden Folgendes mit auf den Weg gegeben: (H. Fritzsche, Archiv Kgm. Kirchen)
„Ihr braucht euern Kopf nicht hängen zu lassen, ihr dürft ihn ruhig hoch tragen, denn Gottes Wort sagt euch, dass ihr eine Krone tragt. Ihr seid Menschen, die unendlich reich sind. Ihr sollt es nicht erst werden, Ihr seid es schon! Unsichtbar hat … Christus euch diese Krone am Tag eurer Taufe aufs Haupt gesetzt.“
Ich komme noch einmal auf das Stereoskop zurück. Wie zwei unterschiedliche Bilder erscheinen unsere menschliche und die göttliche Perspektive. Aber nur beide zusammen ergeben ein wirkliches Bild, das unser Christenleben ausmacht: Manche Unzulänglichkeiten und Fehler auf der eine, und das vorbehaltlose „Ja“ Gottes zu uns auf der anderen Seite. Damit wir das nicht vergessen gilt die Verheißung und Mahnung auch uns: „Haltet fest, was ihr habt, damit niemand eure Krone nimmt.
Amen.
Predigt von Präses Dr. Thorsten Latzel zur Eröffnung der 65. Spendenaktion von Brot für die Welt am Sonntag, 3. Dezember 2023, 11 Uhr, Gemeindezentrum Weyerbusch
Der Friede Gottes und die Liebe Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.

Hunger.
Liebe Gemeinde,
Hunger ist kein Zufall, kein Schicksal, keine eigene Schuld.
Hunger ist eine Waffe, ist Unrecht, ist himmelschreiende Sünde.
Ich selbst musste nie hungern. Bin groß geworden mit vollen Regalen im Supermarkt, der Frage: „Willst du ein Mars, Duplo oder Hanuta?“ Aber das ist nicht mein Verdienst. Geboren zur richtigen Zeit am rechten Ort. Meine Mutter hat Hunger erlebt. Als Flüchtlingskind, Arbeiterfamilie. Als sie ohne irgendetwas dastanden. Im Lager. Und das hat sie geprägt. Zeitlebens. Als sie 18 wurde, wünschte sie sich einen Kringel Fleischwurst, der um ihre Hüften geht. Wohl auch deshalb hat sie später immer mehr gekocht, als wir essen konnten. Damit wurde ich groß.
Hunger ist kein Zufall, kein Schicksal, keine eigene Schuld.
Hunger ist eine Waffe, ist Unrecht, ist himmelschreiende Sünde.
In der vergangenen Woche wurde in der Ukraine des Holodomor gedacht. Der gezielten Tötung von mehreren Millionen Menschen in den 1930er-Jahren durch Zwangskollektivierung, Enteignung, Unterdrückung. Die damalige Sowjetunion verkaufte den Weizen auf dem Weltmarkt und die Bauernfamilien verhungerten wortwörtlich auf der Straße. Eine Erfahrung, die viele zu uns geflohene Ukrainer*innen bis heute nicht vergessen haben. Hunger ist Teil der Geschichte ihrer Familien, ihres Landes.
Weltweit leiden heute 800 Millionen Menschen an Hunger. Jeder zehnte Mensch auf der Erde. Und das, obwohl wir Nahrungsmittel haben, um das Doppelte bis Dreifache der Weltbevölkerung zu ernähren.
Es ist genug für alle da, wenn wir gerecht miteinander teilen.
Mehr als jedes fünfte Kind unter fünf Jahren ist unterentwickelt, weil es nicht genug zu essen, zu trinken, gesunde Nahrung hat.
Hunger hat viele Ursachen: Kriege, Seuchen, Korruption, Missernten, den weltweiten Handel mit Nahrungsmitteln und Ackerböden, den Klimawandel, der schwächere Länder im globalen Süden besonders trifft.
Von dem Ziel der Vereinten Nationen, den Hunger in der Welt bis 2030 zu besiegen, entfernen wir uns gegenwärtig immer weiter.
Hunger ist kein Zufall, kein Schicksal, keine eigene Schuld.
Hunger ist eine Waffe, ist Unrecht, ist himmelschreiende Sünde.
In dem Evangelium von Jesus Christus spielt Hunger eine zentrale Rolle. Die Bergpredigt beginnt damit, dass Jesus die seligpreist, die sich mit Hunger, Armut, Ungerechtigkeit nicht abfinden.
Matthäus 5: „Selig sind, die da geistlich arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen getröstet werden. […] Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt werden.“
Der Evangelist Lukas spitzt das in seiner parallelen Erzählung von der Feldrede Jesu noch weiter zu: „Selig seid ihr Armen; denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert; denn ihr sollt satt werden.“
Beides gehört zusammen: der Hunger nach Brot und der Hunger nach Gerechtigkeit. Weil Armut Unrecht ist. Jesus spricht von sich selbst als Brot des Lebens. Zeigt seinen Jüngerinnen und Jüngern, wie das mit dem Teilen geht: „Gebt ihr ihnen zu essen.“ Am Ende macht er das Teilen von Brot und Wein zum Zeichen seiner Gegenwart unter uns: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.“
Am Umgang mit den Armen unserer Zeit entscheidet sich, wie wir mit Jesus Christus umgehen: „Was ihr diesem meiner geringsten Geschwister getan habt oder nicht, das habt ihr mir getan oder nicht.“
Es ist daher seltsam, wenn manche meinen, Religion sei Privatsache. In Jesus Christus nimmt der Schöpfer der Welt Armut hochpersönlich. Mit Jesus ist kein Staat zu machen und keine Wirtschaft zu entwickeln. Aber mit dem Glauben an ihn ist die Welt zu verändern. Und noch etwas zeichnet Jesu Wirken aus. Er spricht nicht nur von Hunger, Unrecht und Brotteilen. Sondern er bewirkt selbst einen fundamentalen Wandel: den Anbruch von Gottes Reich mitten unter uns. Ein Bild, das Jesus dabei immer wieder wählt, ist das des Säens. Gottes Reich kommt, wie wenn ein Sämann seinen Samen sät. Auch wenn vieles daneben geht: Gottes Reich kommt gewiss. Es kommt mit urwüchsiger Kraft wie eine unaufhaltsam wachsende Saat. Auch wenn es für uns unscheinbar klein sein mag wie ein Senfkorn. Gottes Reich kommt ohne Gewalt, ohne dass wir wüssten, wie. Allein, weil Gott es wirkt. Gott regiert. Das verändert die Welt, unser Leben, alle, die daran glauben. Wandel säen – das ist, was Jesus tut: Er sät den Wandel der Welt in Gottes Reich. Und ist dabei selbst Same und Sämann in einem.
Wandel säen: So heißt die diesjährige 65. Aktion von Brot für die Welt. Sie startet wie immer bewusst im Advent. Weil beides unlöslich zusammengehört: Gottes Kommen und die Liebe zu den Ärmsten. Wir warten auf den Friedefürst, den Brotmenschen, der uns teilen lehrt. Alles hat seine Zeit – und Advent ist die Zeit zum Teilen, zum Brotbrechen, für Brot für die Welt.
In diesem Jahr steht dabei die Demokratische Republik Kongo im Fokus. Trotz oder gerade wegen seiner Bodenschätze ist dieser Staat eines der ärmsten Länder weltweit. Die Menschen dort haben unter jahrzehntelanger Ausbeutung, Kriegen, Korruption und Hunger gelitten. Auch nach den ersten freien Wahlen 2006 ist das Land weiter autoritär regiert. Hunger nach Brot und Gerechtigkeit gibt es bei vielen. Sie als Kirchenkreis Altenkirchen und als Gemeinde Weyerbusch pflegen seit mehr als 40 Jahren eine Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Muku im Osten der Demokratischen Republik Kongo an der Grenze zu Ruanda. Sie haben als Glaubensgeschwister einen starken geistlichen Austausch und haben auch geholfen, als es dieses Jahr eine Flutkatastrophe gab.
Wandel säen.
Mit der Aktion werden konkrete landwirtschaftliche Projekte gefördert, Bildungsarbeit gestärkt, politische Arbeit geleistet. Brot für die Welt fördert bewusst Kleinbauernfamilien im Kongo. Sie können sich so selbst versorgen mit umweltfreundlichen Anbaumethoden. Sie werden in die Lage versetzt, ihr eigenes Saatgut zu vermehren und biologischen Dünger selbst herstellen zu können.
Das passt zu den Ideen des früheren Sozialreformers Friedrich Wilhelm Raiffeisen, der hier im Kirchenkreis Altenkirchen beheimatet war. Als ländliche Region wissen Sie sehr gut, was teilen, säen, Hoffnung geben heißt. Brot für die Welt setzt sich in dem Projekt zugleich für faire Handelsabkommen mit Ländern des Globalen Südens ein.
Hunger ist kein Zufall, kein Schicksal, keine eigene Schuld.
Hunger ist eine Waffe, ist Unrecht, ist himmelschreiende Sünde.
Nein, auch diese Aktion wird nicht einfach alles Leid wenden. Aber sie kann die Schwestern und Brüder vor Ort stärken, sich selbst zu helfen und sich für Menschenrechte, Demokratie, Bildung zu engagieren. Wandel säen. Das heißt: Ich vertraue darauf, dass Gott mit dem Kleinen, was ich tue, etwas Großes anfangen kann. Wandel säen – das heißt: sich mit der Welt, so wie sie ist, nicht abzufinden. „Da kann man nichts machen!“, ist ein zutiefst gottloser Satz. Wandel säen – das heißt: auf Gottes Kommen in unsere Welt zu vertrauen. Gottes Reich ist gegenwärtig, wo immer wir im Geist und in der Nachfolge Jesu Christi handeln.
Einmal wird Gott allen Hunger stillen – den Hunger nach Brot, nach Gerechtigkeit, nach Frieden. Einmal wird Gott alle Tränen trocknen. Dann wird kein Leid mehr sein und kein Geschrei. Einmal werden die Wüsten blühen, werden wir Menschen in Frieden miteinander und mit unseren Mitgeschöpfen leben. Einmal wird Gottes Reich überall offenbar sein. Bis dahin lasst uns im Horizont dieses Reiches Gottes leben, das mitten unter uns gegenwärtig ist. Lasst uns miteinander teilen, anderen helfen, wo immer wir es können.
Lasst uns Liebe leben, so wie Jesus Christus es uns als Herr und Bruder vorgelebt hat. Und dann getrost darauf vertrauen, dass Gott es zu einem guten Ende führt.
Es ist Advent – Zeit, miteinander zu teilen.
Amen.
Foto: Erhard Waßmuth
Ewigkeitssonntag 2023
Text: 2. Petrus 3,8-13 i. A.
Liebe Leserinnen und Leser,
der heutige Sonntag, der letzte im Kirchenjahr, hat interessanterweise zwei Namen: Zum einen nennen wir ihn „Totensonntag“, weil wir an unsere im letzten Jahr verstorbenen Angehörigen zurückdenken und auch an die Verstorbenen früherer Jahre, die unseren Herzen vielleicht noch ebenso nahe sind.
Zum andern trägt dieser Sonntag den Namen „Ewigkeitssonntag“. Mir persönlich gefällt dieser Name besser, weil er nach vorne, in die Zukunft gerichtet ist. Den Totensonntag kann jeder begehen, denn jeder und jede hat im Laufe des Lebens Menschen zu betrauern. Den Ewigkeitssonntag kann dagegen eigentlich nur der begehen, der etwas weiß von dem, der den Tod überwunden hat.
Der heutige Predigttext kann vielleicht eine kleine Hilfe zum Verstehen des Ewigkeitssonntags sein. Er steht im 3. Kapitel des 2. Petrus-Briefes. Dort heißt es:
Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre, und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht; er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren.
Trotzdem: Der Tag des Herrn wird kommen, und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Wie wichtig ist es da, dass ihr ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott führt! Wartet auf den großen Tag Gottes und verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann! Wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert.
Die ersten Christen lebten noch in der Vorstellung, dass Gott sehr bald wiederkommen werde, um sein Reich aufzurichten. Dabei dachten sie vielleicht an ein paar Monate oder allenfalls an einige Jahre. Paulus selbst dachte zunächst, dass er die Wiederkunft Jesu noch erleben würde. Später rückte er von diesem Gedanken ab. Der 2. Petrus-Brief ist sehr viel später entstanden, manche Ausleger datieren ihn ins 2. christliche Jahrhundert, also siebzig oder vielleicht sogar hundert Jahre nach dem Tode Jesu. Der Autor macht darin deutlich, dass Gott in ganz anderen als unseren Kategorien denkt. Heute wissen wir, dass unserer Erde fast fünf Milliarden Jahre alt ist. Wenn wir Gott für den Schöpfer dieser Welt halten, dann verstehen wir heute besser als zu früheren Zeiten, was damit ausgedrückt werden soll, dass 1000 Jahre für ihn wie ein einziger Tag seien. Aber auch das ist nur ein Bild. Wann sein Reich kommt, ist nicht zu sagen, aber dass sein Reich kommt, ist für den Autor ganz gewiss. Er ist fest davon überzeugt, dass Gott die Zukunft gehört und dass die Verzögerung des Anbruchs seines Reiches nicht Schwäche ist, sondern Geduld.
Geduld zu haben mit Kindern, Partnern oder Andersdenkenden ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke! Ein ungeduldiger Lehrer z. B. wird sehr schnell aufgeben, die SchülerInnen vielleicht hart bestrafen oder sie schlecht machen, er wird resignieren. Ein geduldiger Lehrer dagegen wird versuchen, die SchülerInnen immer wieder dazu zu bringen, etwas für ihr Leben zu lernen. Solche Geduld aufzubringen ist für Lehrer heutzutage allerdings wahrlich nicht immer einfach…
Gott ist geduldig, weil es auch ihm darum geht, immer wieder neu um den Menschen zu werben. Er wirbt darum, dass er „Ja!“ sagen zu seinem „Ja!“, das er ihm in der Taufe zugesprochen hat. Er wirbt ein um das andere Mal um den Menschen- aus Geduld..
Wann das Reich Gottes kommt?
Das Evangelium für den heutigen Sonntag (Matthäus 25, 1-13) wird bezeichnet als „Gleichnis von den klugen und törichten Brautjungfern“. Zehn von ihnen sind zur Hochzeitsfeier eingeladen, aber nur fünf haben sich wirklich darauf vorbereitet. Die Ankunft des Bräutigams, der sie abholen soll, verzögert sich, alle zehn schlafen ein, aber als er endlich kommt ist die Hälfte der Damen nicht richtig vorbereitet und kommt nicht rechtzeitig zum Fest.
Jesus, der das Gleichnis erzählt, macht seinen Jüngern damit deutlich: Seid klug und bereitet euch gut auf die Zukunft vor. Versteht die euch verbleibende Zeit als geschenkte Zeit. Nutzt sie, um euch auf das Reich Gottes vorzubereiten und um anderen Menschen davon zu erzählen, zu erzählen von eurer Hoffnung über den Tod hinaus.
Ob an den Gräbern unserer Lieben oder beim Nachdenken über unser eigenes Leben: Selbst wenn wir mit der Welt und dem Leben am Ende sind: Gott ist es nicht. Gott ist nicht fertig mit uns. Seine gute Schöpfung ist noch lange nicht abgeschlossen. Gott wird eine neue Welt schaffen. Als Christen haben wir eine Ahnung von dieser neuen Welt Gottes. Die Bibel selber berichtet in unterschiedlichen Bildern davon, wie diese neue Welt einmal aussehen könnte. Sie ist ein Geschenk Gottes, und sie ist eine Heimat für uns, der wir entgegengehen können.
Am Ende eines Lebens brauchen wir heute oft Worte wie „heimgehen“ oder „heimkehren“. Wir wollen damit das harte Wort „sterben“ umgehen. Das ist eigentlich unnötig, aber die gebrauchten Worte sind dennoch schöne Bilder:
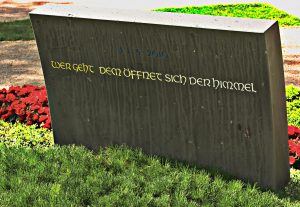
„Heimgehen“ kann nur der, der zu Besuch gewesen ist, zu Besuch in dieser Welt, und der nun unterwegs ist zu seinem Zuhause, seiner eigentlichen Heimat, und „heimkehren“ kann nur der, der an anderer Stelle sein wirkliches Zuhause hat.
Wo Menschen oft schon einen Endpunkt setzen, setzt Gott einen Doppelpunkt: Ihr habt noch viel vor euch, erwartet nicht zu wenig. Was ihr Ende nennt, nenne ich Neubeginn.
Christen können tot-traurig und verzweifelt sein, aber sie sind nie ohne Hoffnung und Mut, nie ohne die Aussicht auf das Reich Gottes. Sie erwarten ihre Zukunft allein von Gott. Ohne diese Hoffnung kann der Glaube nur schwer überleben. Was wäre ein Glaube ohne die Hoffnung auf ein gutes Ende? Was wäre, wenn wir nicht mehr sprächen: „Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben“? Unser Glaube würde Entscheidendes verlieren.
Durch die Auferweckung Jesu hat Gott den Schrecken des Todes zurückgedrängt. Ostern ist der Sieg des Lebens über den Tod. Darum wird in vielen Gemeinden nach jeder Abkündigung eines Verstorbenen der Hymnus angestimmt:
Christ ist erstanden von der Marter alle;
des soll’n wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen;
seit dass er erstanden ist, so lob’n wir den Vater Jesu Christ.
Des soll’n wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein.
Der Autor unseres Predigttextes macht gegen Ende deutlich: Auch und gerade dann, wenn Gott unsere Zukunft ist, ist es nicht gleichgültig, was wir tun. Das Kommen des Reiches Gottes sollte vielmehr ein Ansporn sein, ein Leben zu führen, das Gott gefällt.
Ein Theologe vergangener Tage hat einmal gesagt:
Die Zeit, Gott zu suchen, ist dieses Leben.
Die Zeit, ihn zu finden, ist der Tod.
Die Zeit, ihn zu besitzen, ist die Ewigkeit.[1]
Ich wünsche Ihnen die Zeit, Gott zu suchen, zu finden und zu besitzen.
Amen.
[1] Franz von Sales
22. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: 1. Johannes 2, 7ff
Liebe Leserinnen und Leser,
fällt Ihnen das Aufstehen am Morgen schwer? Sind Sie ein so genannter „Morgenmuffel“? Vermutlich haben die Meisten von uns schon mehr oder weniger oft ihren Wecker verwünscht, vielleicht weil ein schöner Traum kurz vor dem Ende plötzlich abgebrochen ist oder weil man aus dem warmen Bett hinaus in die kalte Wirklichkeit musste? Oder weil wir sofort mit den Gedanken bei dem schwierigen Tag sind, der da nun vor uns liegt, oder weil die Sorgen und Probleme von gestern plötzlich wieder da sind…
Es ist alles andere als schön, wenn der Tag so beginnt. Dabei könnte der Anfang eines Tages auch ganz anders verlaufen, etwa für einen Menschen, der das folgende „Gebet nach dem Erwachen“ spricht:
„Ich bekenne vor dir, du lebendiger und beständiger König,
dass du mir meine Seele wiedergegeben hast.“

Wer so betet, der ist dankbar dafür, dass er lebt, dass er aufstehen kann und die Anforderungen des Tages angehen kann. Ein solches Gebet, ein solcher Gedanke am Anfang des Tages ist wie ein Lichtblick, wie die aufgehende Sonne.
Um einen Lichtblick geht es auch im heutigen Predigttext. Er stammt etwa aus dem Jahr 100 und wird dem Evangelisten Johannes zugeschrieben. Im zweiten Kapitel seines Briefes schreibt er:
Liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt es sich nicht um ein neues Gebot; es sind vielmehr jene alten Gebote, das ihr von Anfang an gekannt habt… Und doch ist das, was ich euch schreibe, zugleich auch ein neues Gebot. Es ist neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht, und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen.
Wer allerdings behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis. Wer aber seine Geschwister liebt, der lebt im Licht und bleibt im Licht, und nichts kann ihn zu Fall bringen. Wer seine Geschwister hasst, der tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht, denn die Finsternis hat ihn blind gemacht.
In diesem zweigeteilten Text geht es zunächst um das Licht. Das passt recht gut in diese Jahreszeit, denn wir merken, wie sehr wir vom Licht abhängig sind. Vor gut einer Woche wurden die Uhren auf die Winterzeit umgestellt und nun wird es schon gegen 17:00 Uhr dunkel. Viele Menschen sehnen sich nach dem Tages-Licht, und die hellen Tage werden ja sogar noch kürzer. Kurz vor Weihnachten ist der kürzeste Tag des Jahres und es ist dann nur knapp neun Stunden hell. Wir tun etwas dagegen: In genau vier Wochen werden uns die Adventskerzen und dann, nochmal vier Wochen später, die Weihnachtslichter die Dunkelheit vertreiben.
Damit kommen Licht und Wärme in unsere Häuser und Wohnungen, aber die Sorgen, die viele Menschen umtreiben, sind damit nicht einfach verschwunden. Und es gibt so viel Sorge und Ängste. Neben ganz individuellen Sorgen um Gesundheit oder Familie gibt e solche, die uns fast alle betreffen: Die Sorge um das Klima, die Energiekosten, Krieg und Terror in der ganzen Welt und eine Gesellschaft, die immer mehr auseinander driftet in sehr arm und sehr reich.
Weil die Sorgen des Lebens durch unsere Kerzen nicht wirklich verschwinden und wir es offensichtlich nicht in der Hand haben, mit noch so tollen Geschenken und überreichem Weihnachtsschmuck Licht in unser Leben und in diese Welt zu bringen, deshalb ist in unserem Text von Gottes Wirklichkeit die Rede, die wie ein helles Licht in das Dunkel unserer Tage scheint. Dabei geht es um die endgültige Überwindung des Dunkels durch das Licht. Gott wurde Mensch und damit kam ein Licht in die Welt, das nicht wieder auszulöschen ist- auch wenn es manchmal nur als schwache Flamme leuchtet.
Niemandem bleibt das Dunkel des Lebens ganz erspart. Eine frühere Mitarbeiterin von mir zitierte immer wieder das Wort „Unter jedem Dach ein Ach…“, was soviel bedeuten soll wie: In jedem Haus oder Haushalt, unter jedem Dach, gibt es irgendetwas, das Sorgen bereitet, seien es finanzielle Schwierigkeiten, Ehestreitigkeiten, Kinderlosigkeit, Krankheit oder Anderes. Nach fast 40 Berufsjahren habe ich die Erfahrung gemacht, dass es genau so ist.
Aber es ist ein Unterschied, ob diese Schwierigkeiten und Beschwernisse für uns wie eine dunkle Mauer sind, die sich drohend vor uns aufrichtet, oder wie ein Tunnel, wie eine Durchgangsstation. Christinnen und Christen dürfen die Erfahrung machen, dass sie durch die Dunkelheiten ihres Lebens hindurch wie durch einen Tunnel gehen, der lang und eng sein kann, an dessen Ende aber ein Licht leuchtet, das Licht der Gnade und Liebe Gottes. Dieses Licht leuchtet auch am Ende des letzten Tunnels, durch den wir alle einmal gehen werden, denn Christus hat das Gesetz, das wir nie ganz erfüllen könnten, für uns erfüllt. Das entlastet im Alltag und auf dem letzten aller Wege.
Im zweiten Teil des Textes geht es darum, wie wir uns als Christinnen und Christen in der Welt zu verhalten haben. Momentan werden wir täglich überrollt von Talk-Shows, Nachrichtensendungen und Dokumentationen über die Themen Krieg und Terror, über die Migrations-Frage, den Klimawandel, Gewalt auf unseren Straßen, hohe Energiepreise usw. Den Autor des ersten Johannes-Briefes würde das vermutlich kaum interessieren. Vielleicht würde er uns schreiben: „Bevor ihr euch um die große Weltpolitik kümmert, kehrt erst einmal vor eurer eigenen Haustür. Bringt euer Verhältnis zueinander und untereinander in Ordnung, dann könnt ihr euch auch um andere Ding kümmern.“
Es geht dem Autor also um das geschwisterliche Miteinander der Christenheit, darum, wie wir mit unseren Glaubensgeschwistern umgehen. Wenn ihr eure Glaubensgeschwister oder „Glaubensgenossen“ nämlich hasst, so schreibt der Autor, dann ist das Licht Gottes noch gar nicht in euch. Wenn ihr euch ihnen gegenüber jedoch liebevoll verhalten, dann ist Gottes Geist in euch, dann seid ihr von seinem Licht erleuchtet.
Warum ist das „christliche Binnenklima“ so wichtig?
Vermutlich besteht ein Grund darin, dass Streit und Rechthaberei innerhalb einer Gruppe nach außen nie einen guten Eindruck macht, sondern Andere eher abschreckt. In der Politik gibt es dafür genügend Beispiele….
Wichtiger und tiefer-gehend aber ist für den Briefschreiber das Argument, dass an unserer Rede von der Liebe Gottes etwas nicht stimmen kann, wenn es schon in den eigenen Reihen nicht klappt. Stattdessen müsste es so sein wie in einer gut funktionierenden Fußballmannschaft. Der ehemalige deutsche Bundestrainer Sepp Herberger wird mit dem Spruch zitiert: „Elf Freunde müsst ihr sein!“. Damit appellierte er 1954 vor dem legendären Endspiel gegen die damals übermächtige ungarische Mannschaft an den Teamgeist seiner Spieler. Und es klappte, Deutschland wurde Weltmeister.
Was ist also zu tun? So wie wir vor aller Beschäftigung mit der Weltpolitik zuerst auf unser Verhältnis als Christinnen und Christen untereinander sehen sollten, so gilt es auch in diesem Verhältnis, klein anzufangen, das heißt in der eigenen Gemeinde: Sich freuen über jeden „Erfolg“ eines Anderen oder einer Anderen, gegenseitige Unterstützung der gemeindlichen Gruppen und Gruppierungen, Zusammenarbeit und Zusammenleben von Jung und Alt, mitleiden, wenn es MitarbeiterInnen oder einzelnen Gruppen in der Gemeinde nicht gut geht, einfach eine große Familie sein, aufeinander zugehen, zuhören, nicht zuletzt füreinander beten.
Danach kann und sollte sich unser Blick weiten, auf den Kirchenkreis und die Landeskirche, aber genauso auf unsere katholischen Geschwister und die Schwestern und Brüder anderer christlicher Kirchen und Gemeinschaften. Und ich füge ausdrücklich hinzu: ebenso zu unseren jüdischen Schwestern und Brüder, von denen wir glaubensmäßig abstammen.
Wir sollten „innerfamiliären“ Meinungsverschiedenheiten auf keinen Fall zu Feindseligkeiten ausarten lassen. Auf der anderen Seite sollten wir als richtig erkannte Positionen nicht um eines Scheinfriedens willen aufgeben. Wir sollten vielmehr versuchen, in das Konzert des christlichen Orchesters unsere Stimme einzubringen, sonst enthalten wir Anderen etwas vor.
In manchen Kirchen steht an jedem Sonntag eine Osterkerze im Altarraum, manchmal sogar angezündet, in anderen Kirchen brennt sie nur, wenn eine Taufe stattfindet. Immer aber werden an der Osterkerze, die für Christus steht, dem Licht der Welt, unsere kleinen Taufkerzen angezündet. Durch sie werden wir immer wieder daran erinnert, dass wir durch die Taufe ein Anrecht darauf haben, dass uns das göttliche Licht jeden Tag unseren Weg erleuchten möchte. Und das gilt selbst für Morgenmuffel…
Amen

21. Sonntag nach Trinitatis 2023 – Predigt zum Reformationstag 2023
Liebe Leserinnen und Leser,
heute möchte ich Ihnen die Grundpfeiler der Reformation vor Augen stellen, die auch als die „vier Soli der Reformation“ bezeichnet werden. Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts fassten nämlich die Grundsätze und Prinzipien ihrer Theologie in vier Schlagworten zusammen:
Sola Gratia (Allein die Gnade),
Sola Fide (Allein der Glaube),
Solus Christus (Allein Christus) und
Sola Scriptura (Allein die Schrift)
Diese vier Prinzipien waren damals eine Reaktion auf die Behauptung der römisch-katholischen Kirche, die einzig wahre Kirche zu sein und als solche die einzig gültige Autorität in Glaubensfragen zu besitzen.
Die schrecklichen Auseinandersetzungen und Kämpfe zwischen evangelischen und katholischen Christinnen und Christen sind glücklicherweise, ich möchte sagen „Gott sei Dank!“ vorbei. In vielen Punkten ist es inzwischen zu einer Annäherung der Kirchen gekommen und es ist ein geschwisterliches Miteinander entstanden. Wenn daher heute an die „vier Soli“ erinnert wird, dann nicht, um Gegensätze zu betonen, sondern um aufzuzeigen, welche Freiheiten und Möglichkeiten die vier „Soli“ uns bieten.
Sola Gratia (Allein die Gnade)
Wenn man nach den Ursachen für die Reformation sucht, wird man eine ganze Reihe von Gründen finden. Was aber damals für Martin Luther „das Fass zum Überlaufen“ brachte und ihn zu seinen 95 Thesen veranlasste, war der Ablasshandel:
Für Geld konnte man damals so genannte Ablassbriefe erwerben. Sie versprachen den Käufern einen dem Geldbetrag entsprechender Erlass von Sündenstrafen im Fegefeuer. Auch für bereits verstorbene Angehörige konnte man gegen Bares solche Versicherungsschreiben erwerben. Der berüchtigte Ablassprediger Johann Tetzel bot einen Ablass an, u. a. um den Bau der Peterskirche in Rom voranzutreiben, deshalb auch Petersablass“ genannt. Tatsächlich ging die Hälfte des Geldes an die Ablassprediger und an Erzbischof Albrecht von Brandenburg, der damit seine Schulden begleichen konnte. Der Werbeslogan Tetzels lautete: „Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel spring“. Luther kritisiert das scharf und argumentierte, der Mensch kenne nicht Gottes „Bewertungskriterien“ am Jüngsten Tag und könne daher keinen solchen Handel betreiben.
Dass die Praxis Tetzels nicht in Ordnung war, wurde später auch von katholischer Seite anerkannt. Der Ablass wurde nicht abgeschafft, aber der Handel mit Ablassbriefen wurde verboten. Kardinal Gerhard Müller sagte, Luther habe mit seiner Kritik am Ablasshandel Recht gehabt und fügte hinzu: „Der Ablasshandel war ein Betrug an den Gläubigen.“ Aber es ging der Reformation um mehr als nur um den Missbrauch des Ablasses. Das Grundproblem bestand darin, dass nach katholischer Ansicht der Mensch bei seiner Erlösung mitwirken könne. Die Reformatoren verwarfen diese Idee und betonten, dass die Erlösung ausschließlich ein Geschenk Gottes sei, das er den Menschen aus reiner Gnade mache. Luther schreibt:
„Ein jeder Christ, der wahre Reue und Leid hat über seine Sünden, hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbrief gehört“.
Luther stützte sich bei diesen Worten hauptsächlich auf den Epheserbrief, in dem
Luther stützte sich bei diesen Worten hauptsächlich auf den Epheserbrief, in dem es im zweiten Kapitel heißt:
Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid!
Hier wird unmissverständlich ausgedrückt, dass der Mensch allein durch Gottes Gnade, sola gratia, das Heil bzw. das ewige Leben erlange und es sich nicht durch noch so gutes Handeln verdienen könne.
Sola Fide (Allein der Glaube)
Während der Grundsatz „Allein die Gnade“ Gott beschreibt als einen gnädigen und liebevollen Gott, der sich dem Menschen trotz seiner Schuld in Liebe zuwendet, beschreibt der Grundsatz „Allein der Glaube“ die einzig angemessene Antwort des Menschen auf Gottes Gnade, nämlich sie im Glauben anzunehmen.
Dass der Mensch einen gnädigen Gott nur im Glauben erfahren kann, führt Luther in einer Predigt im Jahr 1519 so aus:
„Wenn jemand daran zweifelt und nicht fest daran glaubt, er habe einen gnädigen Gott, der hat ihn auch nicht. Wie er glaubt, so hat er.“ (W.A. II, 249).
Das Motto „Allein der Glaube“ kann man daher als das „Grundprinzip der Reformation“ bezeichnen. Martin Luther schreibt an anderer Stelle:
Sola Fide „ist der Glaubensartikel, mit dem die Kirche steht oder fällt. Auf diesem Artikel ruht die ganze Rechtfertigungslehre.“
Die Reformatoren bestanden darauf, dass selbst die besten Werke niemals zum Heil des Menschen beitragen könnten. Wenn der Mensch durch die Befolgung des Gesetzes das Heil erlangen wolle, dann müsse er das Gesetzt auch vollkommen erfüllen. Dies sei aber keinem Menschen möglich. Luther war seinerzeit als Mönch darüber vollkommen verzweifelt. Durch noch so genaue Befolgung des Gesetzes, durch gute Werke und durch Fasten und Beten konnte er keine Gewissheit im Glauben erlangen. Dies änderte sich erst, als ihn eine Stelle im Römerbrief aus seiner Verzweiflung riss. Diese Stelle steht dritten Kapitel des Römerbriefes. Dort schreibt der Apostel Paulus:
Wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert.“ Röm 3,28
Diese neutestamentliche Auffassung fand Luther auch im Alten Testament bestätigt. Im Ersten Buch Mose heißt es über das Leben von Abraham, der damals noch Abram hieß: „Abram glaubte dem Herrn, und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht.“ Gen 15,6
Luther fasste seine Erkenntnis zusammen, indem er nochmals Paulus zitierte, diesmal aus dem Galaterbrief:
Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Gal 3, 11
Daneben war es Luther und den anderen Reformatoren wichtig zu betonen, dass der Glaube, aufgrund dessen allein der Mensch für gerecht erklärt werde, kein toter Glaube sein dürfe, sondern ein Glaube, der aus Dankbarkeit gute Werke hervorbringe.
Solus Christus (Allein Christus)
In der Stadtkirche in Wittenberg befindet sich ein berühmtes Altarbild von Lukas Cranach dem Jüngeren. Es zeigt Martin Luther, der auf einer Kanzel steht und predigt. Er hält eine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger in die Höhe und deutet auf Christus am Kreuz. Cranach interpretiert damit das Wirken Luthers so, dass er vor allen Dingen die Menschen auf Christus verweisen wollte.
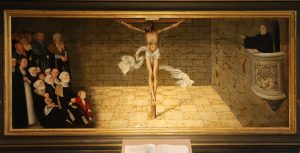
In der Tat war es die Überzeugung der Reformatoren, dem Menschen würde auf seinem Glaubensweg letztlich nur das helfen, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hätte. Das aber reiche vollkommen, um die Fülle der göttlichen Gnade zu empfangen. Sie beriefen sich bei dieser Position vor allem auf ein Wort aus dem 1. Timotheus-Brief: Es gibt nur einen Gott, und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. (1 Tim 2, 5)
Die katholische Kirche lehrte hingegen, dass der Mensch nicht nur Christus, sondern auch andere Mittler brauche, um die Gnade Gottes zu empfangen, etwa Maria oder die Heiligen. Sie sollten durch ihre Gebete bei Gott ein gutes Wort für den sündigen Menschen einlegen. Auch die Kirche sei als Heilsinstitution notwendig. Luther sah mit Sorge, dass die Menschen deshalb ihr Heil nicht mehr von Christus, sondern von der Kirche erwarteten. Die Menschen glaubten, dass die Kirche die Verwalterin der göttlichen Gnade sei, die ihnen nur von den Priestern zugesprochen werden konnte.
Rund 450 Jahre später stellte das Zweite Vatikanische Konzil (1962 bis 1965) auf Christus verweisend fest: „Ein Einziger ist unser Mittler“. Das hätten die Reformatoren genau so ausdrücken können. In den Erklärungen des Konzils heißt es dann aber an anderer Stelle über Maria:
„Indem sie Christus empfing, gebar und nährte… und mit ihrem am Kreuz sterbenden Sohn litt, hat sie beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt…“ Die EKD benennt das Prinzip „solus Christus“ als einen Kernpunkt reformatorischer Theologie: In Christus allein sei Gott eindeutig zu finden, und an Christus allein solle der Mensch glauben.
Sola Scriptura (Allein die Schrift)
Vor einigen Wochen durfte ich in einer Nachbar-Gemeinde eine Taufe vornehmen. Beim Taufgespräch hatten die Eltern noch keinen Taufspruch ausgesucht und ich bat sie, diesen direkt an das Gemeindebüro zu schicken. Das taten die Eltern und wünschten sich als Taufspruch einen Satz eines bekannten modernen Dichters aus. Die Sekretärin hatte ihnen daraufhin deutlich gemacht, dass Taufsprüche aus der Bibel stammen müssten und ihnen auch direkt eine passenden Bibelspruch empfohlen.
Warum muss das so sein? Es gibt doch auch außerhalb der Bibel wichtige Lebensweisheiten und Erkenntnisse. Es hängt zusammen mit der hohen Wertschätzung der Bibel durch die Reformatoren. Sie fassten ihre Stellung zur Bibel zusammen in dem Satz „Allein die Schrift“: Allein die Schrift, also die Bibel, sollte Richtschnur für das Leben der Gemeinde und des Einzelnen sein. Keine kirchliche Autorität stände über der Heiligen Schrift und könne bestimmten, wie die Schrift zu interpretieren sei. Die Bibel sei deutlich und verständlich genug, heißt es doch im 119. Psalm:
Wem sich die Worte Gottes erschließen, „für den verbreiten sie Licht, gerade Unerfahrene gewinnen durch sie Einsicht.“
Die Bibel ist die übergeordnete Norm für das gesamte Leben in Kirche und Alltag. Selbst das Glaubensbekenntnis ist nur von ihr abgeleitet, ebenso alle Traditionen und kirchlichen Verlautbarungen. Alle Äußerungen der Kirche und alle Einsichten des Einzelnen müssen sich immer wieder am Wort Gottes messen lassen.
Die Bibel ist deshalb alleinige Grundlage unseres Glaubens, weil sie das Heil in Jesus Christus bezeugt. Luthers Prüfstein für biblische Texte war das Kriterium, „was Christum treibet“ – das heißt: wo kommt in der Bibel das Evangelium vor? Beim Jakobusbrief fand Luther dieses Kriterium nicht erfüllt, weil dieser Brief den Vorrang guter Werke vertrete. Luther nannte ihn deshalb eine „stroherne Epistel“ und stellte ihn an den Schluss der biblischen Briefe. Dadurch wird deutlich, dass nicht die ganze Bibel Wort für Wort inspiriert ist, sondern dass sie aus folgender Perspektive gelesen und verstanden werden muss: Wo kommt die gute Nachricht von Jesus Christus vor?!
Die vier „Soli“ der Reformation hängen untrennbar zusammen: Allein die Gnade Gottes ermöglicht uns den Glauben, allein der Glaube schenkt und unser Heil, wenn wir ihn allein an Christus ausrichten, der uns in der ganzen Fülle allein in der Schrift begegnet.
Amen.
20. Sonntag nach Trinitatis
Text: Johannes 15, 9-17
Liebe Leserinnen und Leser,
Bertold Brecht hat einmal sinngemäß über die damalige DDR-Regierung gesagt, wenn sie mit dem Volk nicht mehr zufrieden sei, solle sie es doch absetzen und sich ein neues Volk wählen. Das war natürlich beißende Ironie, eine Verhöhnung der so angegriffenen Staatsmacht.
Mancher Diktator verhält sich auch heute noch so, als wenn er seine Untertanen jeden Tag daran erinnern wollte, welche Gnade es für sie bedeute, von ihm regiert zu werden. Entweder ist ein solches Verhalten auf den Verlust des Realitätssinns zurück zu führen, oder es ist der verzweifelte Versuch, ein Unrechtsregime zu legitimieren.
Der heutige Predigttext könnte auf den ersten Blick einen ähnlichen Eindruck erwecken, wenn er von einem Diktator stammen würde, denn es heißt darin: „Ihr habt mich nicht erwählt; sondern ich habe euch erwählt.“
Aber es ist natürlich nicht der Ausspruch eines Despoten, sondern ein Wort Gottes. Der Zusammenhang, in dem dieser Satz steht, ist das Gebot der Liebe, über das Jesus zu seinen Jüngern spricht. Johannes gibt es im 15. Kapitel seines Evangeliums wie folgt wieder:
Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe; das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt.
Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Ein Diener weiß nämlich nicht, was sein Herr tut; ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe.
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt: Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Einander zu lieben – das ist das Gebot, das ich euch gebe.
Dreimal geht es in diesem Text um Entscheidungen:
1 Die Entscheidung Gottes für den Menschen
Es geht in diesem Text u. a. um die Frage, wer in Bezug auf den Glauben den ersten Schritt gemacht hat. Jesus macht den Jüngern deutlich: Bevor ihr etwas von Gott wusstet, bevor ihr euch für ihn entschieden habt, hat sich Gott schon für euch entschieden. Man könnte frei übersetzen: „Nicht ihr habt zuerst mich erwählt, sondern ich habe euch schon von Anfang an erwählt.“
Die Erwählung durch Gott machen wir an einem besonderen Ereignis, einem besonderen Termin fest, nämlich am Tauftag. Die christlichen Kirchen taufen Kinder, besser gesagt Säuglinge. Manch einer nimmt daran Anstoß. Ich selbst bin ein Verfechter der Säuglingstaufe, denn sie macht eines deutlich: Bevor ein Kind zum ersten Mal etwas von Gott, seiner Liebe aber auch seinem Anspruch an sein Leben hört, erfährt es etwas anderes: Gott hat schon lange „Ja“ zu mir gesagt. Ich muss nicht erst tüchtig oder fromm sein, ein bestimmtes Alter haben oder bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Er hat schon lange sein „Ja“ zu mir gesprochen.

Mit diesem „Ja“ Gottes im Rucksack kann ich meinen Weg getrost beschreiten. Gott hat mich erwählt, er hat mich bei meinem Namen gerufen, ich bin sein. Aber ich kann entscheiden, ob ich ihn als Begleiter auf meinem weiteren Lebensweg will oder nicht.
2 Die Entscheidung des Menschen für Gott
Bei der Taufe hat sich Gott festlegt: Er will unser Freund sein, er nimmt uns an, wenn wir wollen, wenn wir zu ihm kommen.
Die Entscheidung des Menschen fällt irgendwann einmal im Laufe seines Lebens. Keine Entscheidung ist übrigens auch eine Entscheidung, nämlich eine Entscheidung gegen Gott.
Die Entscheidung für Gott bzw. der Augenblick, in dem ich dieses „Ja“ zu Gott öffentlich bekenne, kann z. B. die Konfirmation sein. Mit ihrem „Ja“ zu Gott und zur Gemeinde bestätigen die Konfirmierten Gottes Erwählung, bestätigen sie Gottes Anspruch auf ihr Leben. Sie tun dies durch das Bekenntnis ihres Glaubens bzw. durch die positive Beantwortung der Konfirmationsfrage.
Ganz ähnlich ist es bei der Firmung. Der Name stammt vom lateinischen „confirmatio“ ab, genau wie das Wort „Konfirmation. „Confirmatio“ bedeutet so viel wie Bestärkung oder Bekräftigung. Mit der Firmung bestätigen die daran teilnehmenden Jungen und Mädchen das Taufversprechen, das ihre Eltern und Paten bei der Taufe für sie abgegeben haben.
Jesus ermahnt seine Jünger, in der Liebe Gottes aber auch zu bleiben. Die christlichen Gemeinden hegen diesen Wunsch auch, den Wunsch, dass die jungen Menschen, die einmal „ja“ zu Gott gesagt haben, in der Gemeinde, in der Kirche, bei Gott bleiben mögen. Zugleich ist es kein Geheimnis, dass viele nicht bleiben oder nur ganz selten wiederkommen! Wie sich der Glaubensweg eines Menschen nach seinem Bekenntnis zu Gott entwickelt, ist sehr unterschiedlich. Manche Jugendliche tauchen erst einmal kirchlich gesehen ab, manche tauchen als junge Erwachsene wieder auf, andere nicht.
Neben der grundsätzlichen Frage, ob wir „Ja“ sagen zum Angebot Gottes, bleibt es an jedem Tag die Herausforderung eines Christenlebens: Was ist meine kleine Antwort auf Gottes „Ja“ zu mir an diesem Tag?
3 Die Entscheidung des Menschen für den Menschen
Der Satz über die Erwählung des Menschen durch Gott hat noch eine zweite Hälfte. Bei dieser zweiten Hälfte handelt es sich um eine Aufgabe für den Menschen:
Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen, Frucht, die Bestand hat.
Unsere Erwählung durch Gott ist kein Selbstzweck. Zum einen hat sie natürlich den Sinn, unserem Leben ein Ziel zu geben, uns zu stärken und zu stützen. Aber dabei soll es nicht bleiben. Die von Gott Erwählten sollen das Leben und die Welt im Geist Gottes gestalten, sollen, wie Jesus es nennt, Frucht tragen, gute Frucht natürlich.
Wie sieht das in meinem Leben aus? Ist das bisher gelungen? Habe ich mich dieser Aufgabe überhaupt gestellt? Und wie stellt sie sich in meiner gegenwärtigen Lebensphase dar? Wie und wo könnte ich da „Frucht tragen“?
Es gibt keine Antwort, die auf alle Menschen passt. Aber ich bin davon überzeugt, dass Menschen jedes Alters aus ihrem Glauben heraus Früchte bringen können, andern Menschen zum Nutzen und Gott zur Ehre. Das unumkehrbar „Ja“ Gottes zu uns kann uns dabei immer wieder die nötige Motivation geben.
Amen.
19. Sonntag nach Trinitatis 1923
Text:: Lukas 15, 25-32
Liebe Leserinnen und Leser,
den Meisten von Ihnen dürfte das so genannte Gleichnis vom „verlorenen Sohn“ bekannt sein. Um dieses Gleichnis geht es heute, allerdings nur am Rande um den jüngeren Sohn, hauptsächlich aber um seinen älteren Bruder.
Wir erinnern uns:
Der Sohn eines reichen Landbesitzers hatte es satt, immer nur zu Hause zu sein. Er wollte sein Leben genießen und damit nicht warten, bis sein Vater gestorben sein würde. Deshalb bat er seinen Vater, ihm sein Erbe vorzeitig auszuzahlen. Tatsächlich ließ der sich darauf ein. Jetzt war der Sohn frei, ging von Zuhause fort und konnte ein schönes Leben führen, Geld hatte er, Freunde und Freundinnen auch, das Leben machte ihm Spaß. Dann aber ging ihm das Geld aus und die Freunde verließen ihn. Um leben zu können, arbeite er als Schweinehirt. Schmutz und Gestank aber ließen den Gedanken an sein Zuhause in ihm wachsen. Er könnte ja wenigstens Arbeiter bei seinem Vater werden… Irgendwann nahm er all seinen Mut zusammen und macht sich auf nach Hause. Als er näherkam, war ihm, als hätte der Vater nur auf ihn gewartet. Der Vater lief auf ihn zu, umarmt ihn und ließ zur Feier des Tages ein großes Fest ausrichten.
Hier setzt der heutige Predigttext aus dem Lukasevangelium ein:
Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er zurückkam, hörte er schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. „Dein Bruder ist zurückgekommen, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wiederhat.“ war die Antwort. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: „Viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können! Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten!“ Der Vater sagte ruhig: „Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen; denn dieser hier, dein Bruder, war tot, und nun lebt er wieder; er war verloren, und nun ist er wiedergefunden.“
Hatte der ältere Sohn nicht irgendwie Recht, mit dem, was er sagte? Er hatte gearbeitet, geschuftet, während der andere das Geld versoffen und verprasst hatte.
Es gibt solche Brüder (und wohl auch Ehemänner), mit denen man nur schwer zusammenleben kann. Aber alle Welt liebt diese Menschen, während niemand sieht, was die Anderen alles tragen und ertragen müssen. Man könnte sich fragen: Wo ist der gerechte und liebende Gott bei so viel Ungerechtigkeit?
Das Gleichnis antwortet darauf mit den Worten: „Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu.“ Da ist Gott, bei dem schimpfenden Bruder draußen, der so Recht hat. Gott ist nicht im Festsaal. Er ist nicht dort zu finden, wo es feierlich zugeht und alle Rätsel gelöst sind. Er ist dort, wo einer aufbegehrt, selbst da, wo jemand nicht mehr an Gott glauben kann.
Die Hilflosigkeit des Vaters ist mit Händen zu greifen: Er steht draußen vor der Tür und hat nichts als das Wort, mit dem er seinen Sohn einlädt. Natürlich könnte er Knechte rufen und den Sohn in den Festsaal hineinschleppen lassen. Aber das würde wohl wenig bringen, denn das Herz seines Sohnes wäre dann ja nicht dabei. Liebe kann man nicht erzwingen. All sein Werben um den Älteren legt der Vater deshalb in seine Worte. Mehr kann er nicht tun. Er hat auch den jüngeren Sohn nicht von der Polizei holen lassen, er hat auch ihm gegenüber nichts anderes gehabt als seine Liebe. Darum kann er nur draußen stehen und warten.

Gott hat nichts als sein Wort. Aber er hat diesem Wort in Jesus Christus menschliche Gestalt gegeben, um uns in den Festsaal einzuladen.
Nichts kann oder will Gott, nichts kann oder will Jesus, als Menschen einzuladen. Der jüngere Sohn ist der Einladung gefolgt. Und der ältere? Der Landbesitzer, der ein Bild ist für Gott, sagt zu ihm: „Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Vielleicht haben wir das gar nicht bemerkt oder haben es mit der Zeit vergessen: Wir sind schon längst bei ihm.
Vor wenigen Tagen habe ich im Deutschlandfunk eine Sendung über Palliativ-Stationen gehört. Selten hört man dort religiöse Äußerungen. Diesmal war ich sehr erstaunt darüber, dass ein älterer Mann erzählte, wie ihm die Jahreslosung 2023 geholfen habe, mit seiner Krankheit und der negativen Prognose umzugehen. Die Jahreslosung stammt aus dem ersten Buch Mose und lautet:
„Du bist ein Gott, der mich sieht.“
Gott sieht uns, das allein ist schon tröstlich. Aber er sieht uns nicht nur, er lädt uns ein wie den älteren Sohn: Komm in den Festsaal! Feiere mit. Du bist doch eigentlich schon längst da, mach den Schritt über die Schwelle des Hauses, das doch dein Haus, dein Vaterhaus ist.
Der Ältere scheint nur seine Arbeitsstunden zu sehen und kann darum die Liebe des Vaters nicht erkennen. Wenn er nicht hineingeht, kann er weder den Kalbsbraten noch den alten Wein genießen.
Hier endet das Gleichnis Jesu. Er lässt die Zuhörerinnen und Zuhörer allein mit dem älteren Bruder. So wie der ältere Bruder kann auch die Zuhörerschaft, zu der wir selber ja auch gehören, entscheiden, ob sie in den Festsaal eintreten will oder nicht. Wir haben eine Einladung vom Hausherrn persönlich. Wenn wir uns einladen lassen und eintreten, dann geschieht etwas. Da wird das ohnmächtige, hilflose Wort Gottes zu einer Kraft, die durch Zeit und Ewigkeit hindurch trägt.
Könnte das nicht der Sinn des Lebens sein, die Einladung Gottes, an seinem Festtisch sitzen zu dürfen, anzunehmen?!
Lassen wir uns einladen, wir, die wir so vieles richtig machen und doch manchmal blind sind für die Liebe Gottes, vor allem wenn sie Anderen gilt!
Amen.
18. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Exodus 20, 1-17
Liebe Leserinnen und Leser,
ein Kollege zeichnete vor einiger Zeit in einer seiner Predigten das Gespräch nach, das Gott mit Mose führte -oder besser: geführt haben könnte- bevor er dem Volk die so genannten „Zehn Gebote“ übergab. In der Predigt heißt es:
„So wird das immer wieder sein“, sagte Gott zu Mose. „Da sind Menschen frei, und dann sind sie ratlos: Was fange ich mit meiner Freiheit an? Wie sollen wir unser Leben gestalten? Woran sollen wir uns orientieren? so fragen sie. Darum muss ich zu ihnen reden.“ – „Gut“, sagte Mose und hielt die Tontafel und den Griffel schreibbereit, „und die Überschrift? Vielleicht: Gottes Anordnungen?“ – „Nein“, wehrte Gott ab, „ich bin kein Befehlshaber, ich bin ein Befreier. Meine Worte sollen für sie ein Geschenk sein. Schreib einfach: Wort Gottes.“ Und Mose schrieb: „Und Gott redete all diese Worte.“
„Bis jetzt haben sie nur mein Handeln erfahren“, sagte Gott nachdenklich, „aber dass ich es bin, dem sie ihre Freiheit verdanken, ob sie das immer wissen? Ich liebe mein Volk. Darum möchte ich ihnen gleich zu Anfang das größte Geschenk machen, ihnen sagen, dass ich ihr Gott sein will, mich an sie binden will.“ Und Mose schrieb: „Ich bin Jahwe, Dein Gott, der ich Dich aus Ägypten befreit habe.“ „Ja, das ist gut“, sagte Gott, „aber füge noch ein: Der ich Dich aus der Knechtschaft befreit habe, denn es gibt vieles, was meine Menschen versklavt und fesselt, Zwang und Druck ausübt. Aus alledem will ich immer wieder befreien. Ja, und weil ich die Freiheit meiner Menschen will, will ich ihr Gott bleiben, wo immer sie auch sind, wie immer es ihnen auch geht. Darum brauchen sie nur mich, keine anderen Götter.“ – Und Mose schrieb: „Darum brauchst Du keine andern Götter neben mir haben.“
„Und weiter?“ fragte Mose.
Soweit der Kollege. Die dann folgenden Gebote kennen wir meist besser als die ersten, so wichtig die auch sein mögen. Die Gebote vier bis zehn lauten nach der Aufzeichnung im zweiten Buch Mose wie folgt:
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der HERR, dein Gott, geben wird.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht ehebrechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel noch alles, was dein Nächster hat.
Diese Gebote beschäftigen sich ganz offensichtlich mit dem Umgang der Menschen untereinander. Wir werden darin aufgefordert, nicht zu töten, nicht zum stehlen, die Ehe nicht zu brechen, nicht zu lügen und nichts zu begehren, was anderen Menschen gehört. Die Reihenfolge geht vom schlimmsten, dem Töten, zum weniger Schlimmen, dem Neid, aber sie geht auch von der eher seltenen Tat des Tötens zur häufigsten, dem Neid. All diesen Geboten ist gemeinsam, dass sie das Miteinander der Menschen fördern wollen, dass sie dafür sorgen wollen, dass die Gemeinschaft funktioniert und keinen Schiffbruch erleidet. Beim Töten ist das am deutlichsten zu erkennen, aber auch Lügen und Neid können eine Gemeinschaft untergraben und zerstören. Gebote sind also keine Einschränkungen, nichts Bedrückendes und Belastendes, sondern sie ermöglichen eine funktionierende Gemeinschaft.
Dass die Gebote kein Zwang, kein Druck und keine Bevormundung sein wollen, ging aus dem zu Beginn zitierten Predigtabschnitt ja schon sehr eindrucksvoll hervor: Gott bietet uns seine Freundschaft an, seine Begleitung auf allen Lebenswegen. Und dann zeigt er uns in den folgenden Geboten, wie wir als von ihm geliebte Menschen ein geordnetes Leben führen können. Die Gebote sind also sinnvolle „Spielregeln“ für das Zusammenleben der Menschen. Es geht nicht um blinden Gehorsam, auch nicht um Angst vor Strafe, wenn wir bestimmte Gebote einmal übertreten haben sollten…
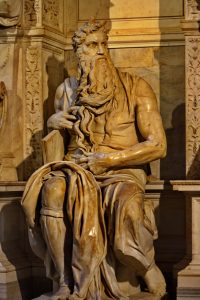
Aber so wichtig und sinnvoll, so gut und nützlich die Zehn Gebote auch sind: Gebote sind genau so wenig der Weg zu Gott, wie Verkehrsregeln die Straße selber sind oder die Bojen im Fahrwasser der Seeweg selber. Gebote wollen uns helfen, uns Halt und Orientierung geben, nicht selber der Weg zu Gott sein. Der Apostel Paulus spricht sogar davon, dass Christus das Ende des Gesetzes sei. Er geht damit gegen das Missverständnis vor, dass Gesetze und Gebote eine „Heilsbedeutung“ haben. Der Weg zu Gott führt für Paulus nicht über die Einhaltung der Gebote. Das ist eine klare Botschaft im Neuen Testament, aber auch im so genannten „Alten Testament“ führt die Gerechtigkeit vor Gott keineswegs über die guten Taten und das Einhalten der Gebote: Mose, der ein Mörder war, durfte das Volk Gottes aus der ägyptischen Gefangenschaft führen und Abraham, der immer versuchte, die Gebote Gottes einzuhalten, wurde nicht dafür gerechtfertigt, sondern durch seinen Glauben, d. h . durch sein Vertrauen, das er auf Gott setzte.
Wenn wir alte Gemälde von Mose mit den Gesetzestafeln sehen, dann fällt auf, dass er oft mit zwei Hörner dargestellt wird. Selbst eine der berühmtesten Statuen der Welt, der Moses des Michelangelo, hat solche Hörner. Mose „verdankt“ sie der fehlerhaften Übersetzung eines hebräischen Wortes in der im Mittelalter bekanntesten lateinischen Bibelübersetzung, der Vulgata.
Statt des lateinischen Wortes für „strahlend“ wurde dabei ein Wort verwendet, das „gehörnt“ bedeutete. Darauf berief man sich lange Zeit in Kirche und Kunst. Das ist eher kurios. Fast immer ist Mose aber auch mit zwei Tafeln abgebildet:
A uf der einen Tafel sind das erste, zweite und dritte Gebot zu sehen, die übrigen Gebote befinden sich auf der der zweiten Tafel. Meinst sind auf den Tafeln Bildern nur die römischen Zahlen zu sehen, nicht der Text, den aber kannte man früher ohnehin. Auch wenn die Gebote auf zwei verschiedene Tafel stehen, sie gehören doch untrennbar zusammen. Jesus sagt später einmal, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, also rechte und linke Tafel, das sei die Erfüllung des Gesetzes.
uf der einen Tafel sind das erste, zweite und dritte Gebot zu sehen, die übrigen Gebote befinden sich auf der der zweiten Tafel. Meinst sind auf den Tafeln Bildern nur die römischen Zahlen zu sehen, nicht der Text, den aber kannte man früher ohnehin. Auch wenn die Gebote auf zwei verschiedene Tafel stehen, sie gehören doch untrennbar zusammen. Jesus sagt später einmal, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, also rechte und linke Tafel, das sei die Erfüllung des Gesetzes.
Kommen wir noch einmal zurück auf die Funktion der Gebote. Der Theologe Ernst Lange hat einmal Folgendes geschrieben:
Auf die Frage, was das Christentum sei, antwortete ein Junge:
„Christentum ist das, was man nicht darf.“
So denken viele. Und wenn man sie nach dem Grund für diese merkwürdige Ansicht fragt, reden sie von den Zehn Geboten: Da heißt es doch immer ,Du sollst nicht‘!“
Was für ein ungeheuerliches Missverständnis! Gott Ist kein Zwingherr, sondern der Befreier. Er befreite sein Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten. Dann führte er es zum Berg Sinai. Und vom Berg Sinai aus machte er ihm klar, wie groß die Freiheit ist, die man mit Gott hat.
Er machte ihnen das klar in zehn Sätzen… alle fangen an: „Ich, Gott, und du, Mensch, wir gehören jetzt zusammen. Und wenn wir zusammen bleiben, dann wird dein Leben folgendermaßen aussehen:
– Du wirst keine andern Götter haben,
– Du wirst meinem Namen Ehre machen,
– Du wirst dich nicht zu Tode hetzen,
– Du wirst in deiner Familie ein menschliches Leben finden…“
Und so weiter.
Die zehn Gebote sind die zehn Artikel der großen Freiheit, die Gott schenkt.
Die „Zehn Gebote“ sind ein Angebot Gottes an uns, und er verspricht: Wer immer dieses Angebot annimmt, wird es nicht bereuen.
Amen.
Erntedank 2023
Text: Matthäus 6, 19-21
Liebe Leserinnen und Leser,
vor einigen Monaten waren -sage-und-schreibe- 120 Millionen Euro im Euro-Jackpot! Wenn ich solche Zahlen höre, fange ich manchmal an zu rechnen:
120 Millionen Euro, was könnte man damit nicht alles machen?
Man könnte sie auf die Bank bringen und hätte jede Woche ca. 100.000 Euro zum Ausgeben, 14.000 € pro Woche, sein Leben lang, und das Kapital bliebe sogar fast erhalten. Was könnte man mit dem Geld alles Gutes tun, ein Tausender hier und da würde nicht einmal wehtun…
Fast jeder, mit dem ich schon einmal über das Lottospielen geredet habe, hat behauptet, wenn er ein paar Millionen gewinnen würde, würde er auf jeden Fall eine großzügige Spende an eine gemeinnützige Organisation oder an die Kirche machen…
Es ist leicht, über Geld zu reden, das man nicht hat. Beim eigenen Geld sieht das aber ganz anders aus: Charly Brown wird einmal von seiner Freundin gefragt:
„Wenn du 2 Millionen Euro hättest, würdest du mir eine Millionen abgeben?“
„Ja.“
„Wenn du zwei Häuser hättest, würdest du mir eines schenken?“
„Ja.“
„Und wenn du zwei Tafeln Schokolade hättest, würdest du mir eine abgeben?“
„Nein.“
„Aber warum nicht?“
„Ich habe zwei Tafeln Schokolade…“
So ist das: Schätze, die man nicht hat, verteilt man gern, aber eine von zwei Tafeln Schokolade herzugeben, da wird unser Wille zum Teilen schon auf eine echte Probe gestellt…
Auch im heutigen Predigttext geht es um „Schätze“. In der Bergpredigt sagt Jesus darüber Folgendes:
Sammelt keine Schätze und Reichtümer auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.
Drei Arten von Schätzen gilt es offenbar zu unterscheiden:
Schätze, die von Motten gefressen werden
 Der französische Fußballstar Kylian Mbappé verdient rund 250.000 Euro, was an sich nicht unangemessen wäre, würde es sich dabei um das Jahresgehalt handeln und nicht um den Verdienst eines einzigen Tages. Sein Jahres-Gehalt beträgt rund 100 Millionen Euro.
Der französische Fußballstar Kylian Mbappé verdient rund 250.000 Euro, was an sich nicht unangemessen wäre, würde es sich dabei um das Jahresgehalt handeln und nicht um den Verdienst eines einzigen Tages. Sein Jahres-Gehalt beträgt rund 100 Millionen Euro.
Machte es Sinn, solche Reichtümern anzuhäufen, zumal es Menschen gibt, die noch reicher sind? ? Kann man mehr als gut essen, trinken, sich gut kleiden und gut wohnen, sich ein paar Wünsche erfüllen? Was bleibt davon am Ende und was „fressen die Motten“ wie es Jesus ausgedrückt hat?
Das Evangelium, über das heute in vielen Gottesdiensten gepredigt wird, handelt von einem reichen Kornbauern (Lukas 12, 15-21: Er hat eine ganz besonders gute Ernte gehabt und überlegt: Was soll ich nun tun? Er kommt zu dem Entschluss, große Vorratshäuser zu bauen, wo man das Korn lagern kann und ist daraufhin mit sich und der Welt zufrieden. Er denkt, mir kann nichts mehr passieren, mein Leben ist in jeder Hinsicht abgesichert! Dabei vergisst er, dass man eben nicht alles im Leben planen und absichern kann, und tatsächlich, noch in der Nacht seines vermeintlichen Erfolges stirbt er.
John David Rockefeller war unfassbar reich, aber er sagte: „Ich habe viele Millionen verdient, aber das Glück haben sie mir nicht gebracht.“ Und Henry Ford bekannte im Alter: „Ich war glücklicher, als ich noch Mechaniker war.“ Je reicher ein Mensch ist, desto mehr hat er zu hüten und zu verwalten, aber auch zu verlieren. Wie schnell hängen wir unser Herz an materielle und vergängliche Dinge! Der Philosoph Arthur Schopenhauer sagt: „Geld ist wie das Meereswasser: Je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man.“
Jesus verurteilt den Reichtum nicht. Er möchte vielmehr zum Nachdenken darüber anregen, was wirklich wichtig ist und was am Ende wirklich zählt.
Schätze, die in unserem Inneren liegen
Wenn der äußerliche Reichtum nicht das ist, was erstrebenswert, sondern sogar gefährlich ist, dann muss es wohl um einen Reichtum gehen, der in unserem Inneren zu finden ist.
Gestern habe ich von einem Arzt gehört, der Gott jeden Morgen für jedes seiner Organe gedankt haben soll. Als Arzt kannte er sie alle beim Namen, und dankbar zu sein beeinflusst einen Tag sicher mehr zum Positiven hin, als den ganzen Tag über seine wirklichen oder vermeintlichen Wehwehchen zu klagen.

Wahrer innerer Reichtum aber ist noch etwas anderes, als einen gesunden Darm und eine intakte Leben zu haben. Inneren Reichtum kann auch der besitzen oder erwerben, dessen Organe nicht alle gesund und funktionsfähig sind.
Wahrer innerer Reichtum ist ein ungeheuer großer, aber nicht wirklich messbarer Wert. Er hat sehr wenig mit dem Stand meines Bankkontos zu tun, aber sehr viel mit dem Herzen und dem inneren Wohlbefinden, mit Zufriedenheit und Ausgeglichenheit, mit Freundschaften und Liebe. Reich kann in diesem Sinne der ärmlich aussehende Fischer am Mittelmeer sein oder das verliebte Paar im rostigen Golf II. Einen Menschen zu lieben, ja mehr noch: sich von einem Menschen geliebt zu wissen, das macht uns reicher, als jeder Lottogewinn uns machen könnte.
Gestern morgen habe ich ein Reportage über ehrenamtliche Mitarbeiterinnen bei der Betreuung von dementen Personen gehört. Eine Betroffene sagte, wenn die ehrenamtliche Person das Zimmer betreten würde, ginge für sie die Sonne auf. Die Ehrenamtliche Person sagte daraufhin, solche Worte seien ihr mehr wert als 1000 Euro.
Udo Jürgens hat es in einem seiner Lieder einmal so ausgedrückt:
Wenn du mitunter traurig bist,
es mag sein vielleicht,
weil das Geld nie reicht,
dann sag‘ dir, dass da manches ist,
was der reichste Mann
sich nicht kaufen kann.
Es gibt: Sehnsucht! Träume!
Nachts das Rauschen der Bäume!
Es gibt: Treue! Freunde!
Jemand, der zu dir hält!
Was wirklich zählt auf dieser Welt,
bekommst du nicht für Geld!
Schätze, die im Himmel sind
Die von Udo Jürgens aufgezählten Werte wie Treue oder Freundschaft sind ohne Zweifel innere, nicht-materielle Schätze, von denen wir nie zu viel haben können. Aber sie sind doch nicht das, was Jesus als „Schätze im Himmel“ bezeichnen würde. Was aber ist ein „Schatz im Himmel“ dann?
Wir tragen diesen „Schatz“ eigentlich schon seit unserer Taufe bei uns: Es ist eine ganze Schatzruhe, die wir da erhalten haben. Wenn wir die allerdings unbeachtet in der Ecke stehenlassen, nutzt sie uns genau so wenig, wie ein Rettungsboot, bei dem wir vergessen haben, es beizeiten aufzublasen.

Wenn ich die Schatztruhe jedoch öffne, entdecke ich ein ganze Anzahl von einzelnen Schätze:
– Ich kann mich jederzeit an Gott wenden.
– Gott sagt „ja“ zu mir: ohne Vorbehalte oder Vorleistungen.
– Bei Gott zählt nicht Leistung und Frömmigkeit, sondern allein der Glaube.
– Ich habe ein „Dauerkarte“ im Haus Gottes.
– Ich bin nicht weniger als ein Kind Gottes!
Und vor allem: Ich habe eine Zukunft, unvorstellbar zwar, fest versprochen, eine Zukunft, die über dieses Leben hinausgeht, die Zusage, in Zeit und Ewigkeit bei ihm geborgen zu sein.
Lassen Sie uns doch in diese Schatzkiste, die Schätze erhält, die unzerstörbar sind, immer wieder einmal hineingreifen. Amen.
16. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Matthäus 22, 15-22
Liebe Leserinnen und Leser,
 auf der hier abgebildeten Silbermünze ist das Bild einer europäischen Monarchin zu sehen. Die Münze stammt aus dem Jahr 1966 und zeigt das Bild von Juliane, der damaligen Königin der Niederlande. Ich habe die Münze hier abgebildet, weil es im heutigen Predigttext auch um eine Münze geht, mit der man Jesus damals eine Falle stellen wollte. Leider besitze ich keine Münze aus der Zeit Jesu, darum muss diese moderne Münze einspringen. Das Prinzip ist nämlich immer noch das gleiche: Auf Münzen ist der jeweilige Herrscher zu sehen und so weit, wie dessen Herrschaftsbereich reicht, so weit sind seine Münzen in Geltung.
auf der hier abgebildeten Silbermünze ist das Bild einer europäischen Monarchin zu sehen. Die Münze stammt aus dem Jahr 1966 und zeigt das Bild von Juliane, der damaligen Königin der Niederlande. Ich habe die Münze hier abgebildet, weil es im heutigen Predigttext auch um eine Münze geht, mit der man Jesus damals eine Falle stellen wollte. Leider besitze ich keine Münze aus der Zeit Jesu, darum muss diese moderne Münze einspringen. Das Prinzip ist nämlich immer noch das gleiche: Auf Münzen ist der jeweilige Herrscher zu sehen und so weit, wie dessen Herrschaftsbereich reicht, so weit sind seine Münzen in Geltung.
Der Evangelist Matthäus berichtet im 22. Kapitel seines Evangeliums Folgendes:
Eines Tages hatten einige Pharisäer ihre Schüler zu Jesus geschickt. Auftragsgemäß sprachen sie ihn an:
„Meister, wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten. Du fragst nicht, was die Leute dazu sagen. Darum sag uns: Ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen, oder nicht?“
Jesus durchschaute sie und sagte: „Warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuer bezahlt!“ Sie reichten ihm einen Denar.
„Wessen Bild und Name ist darauf?“, fragte er. Sie antworteten: „Das Bild und der Name des Kaisers.“ Da sagte Jesus zu ihnen: „Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört!“ Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie Jesus in Ruhe ließen und weggingen.
Einige Pharisäer wollen Jesus eine Fangfrage stellen. Sie schicken dazu ihre Jünger vor, die Jesus zunächst schmeicheln, dann aber die verfängliche Frage stellen: „Ist es richtig, dem Kaiser in Rom Steuern zu zahlen?“
Jesus lässt sich eine römische Steuermünze zeigen: Auf der Münze ist das Bild des Kaisers und die Aufschrift: „Kaiser Tiberius, Sohn des göttlichen Augustus, Oberpriester“. Jesus sieht die Münze an und gibt die orakelhafte Antwort: „Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist“.
Können wir hier und jetzt mit der Antwort etwas anfangen?
Geprägt sein oder verblasst sein…
 Die sehen hier noch eine zweite Münze. Anders als bei der ungebrauchten Münze aus den Niederlanden ist dieser Münze fast 370 Jahre alt und das Gesicht des damaligen Herrschers ist bis zur Unkenntlichkeit abgenutzt. Das Geldstück ist offenbar durch unzählig viele Hände gegangen. Nur durch die Umschrift lässt sich bestimmen, dass es sich bei dem Herrscher um Leopold I handelt, den damaligen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.
Die sehen hier noch eine zweite Münze. Anders als bei der ungebrauchten Münze aus den Niederlanden ist dieser Münze fast 370 Jahre alt und das Gesicht des damaligen Herrschers ist bis zur Unkenntlichkeit abgenutzt. Das Geldstück ist offenbar durch unzählig viele Hände gegangen. Nur durch die Umschrift lässt sich bestimmen, dass es sich bei dem Herrscher um Leopold I handelt, den damaligen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches.
Münzen werden in Europa in der Regel geprägt. Was auf dem Prägestock vorgegeben ist, das prägt sich buchstäblich in das Metall ein.
Eine solche Prägung ist ein schönes Bild für den Glauben: Wir werden durch Eltern, Paten, Pfarrerinnen etc. in unserem Glauben geprägt. Erkennt man an uns diese Prägung? Erkennt man unseren Glauben, hat er Konturen, hebt er sich vom Übrigen ab? Oder sind wir profillos und unkenntlich wie bei der Münze aus dem 17. Jahrhundert?
Wir sollten als Christinnen und Christen wie eine frisch geprägte Münze klare Kante zeigen bei den großen und kleinen Fragen unseres Alltags: am Stammtisch, bei der Arbeit, in der Politik, bei Sport und Freizeit und nicht zuletzt gegenüber Kindern und Enkeln…
Fragen und Antworten
Ein Mann wird gefragt: „Schlagen Sie Ihre Kinder immer noch?“ Er überlegt: Sagt er „nein“, antwortet der Fragesteller vielleicht: „Gut, dass Sie endlich damit aufgehört haben.“ , unter unterstellt so, dass der Gefragte das jahrelang getan habe. Sagt der Gefragte „ja“, ist das Ganze ohnehin ein Fall für den Staatsanwalt. Man kann die Frage also nicht angemessen mit „ja“ oder „nein“ beantworten.
In einer ähnlichen Lage ist Jesus: Würde er es befürworten, dem Kaiser in Rom Steuern zu zahlen, stünde er damit im Widerspruch zu der Mehrheit seiner Landsleute die die römische Besatzung hasste. Mit einem „Nein“ aber stände er im Widerspruch zur römischen Autorität, die man dann zum Einschreiten gegen ihn auffordern könnte. Jesus gibt daher keine eindeutige Antwort, jedenfalls keine, die man ohne nachzudenken einfach übernehmen kann.
Es gibt auch heute Fragen, auf die wir nicht einfach mit „ja“ oder „nein“ antworten können. Vor wenigen Tagen fragte mich ein Bekannter, ob meiner Meinung nach Sterbehilfe erlaubt sei. Auch mir fiel -über den Kaffeetisch hinweg- eine einfache Antwort schwer und ich musste an „meinen“ früheren Chef, Nikolaus Schneider, denken. In evangelisch.de war über ihn im Januar 2021 Folgendes zu lesen:
Anne und Nikolaus Schneider wurden als Ehepaar bekannt, weil sie in der politischen Debatte um das Verbot organisierter Sterbehilfe öffentlich eine Kontroverse austrugen. Anne Schneider plädierte für das Recht auf ärztlich assistierten Suizid, der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider, vertrat damals die Position der Kirche, wonach das nicht erlaubt sein sollte. Schneider hatte 2014 sein Amt wegen der Brustkrebserkrankung seiner Frau vorzeitig niedergelegt. In der erneuten Debatte bleibt Anne Schneider bei ihrer Meinung, ihr Mann hingegen hält es mittlerweile für denkbar, dass Menschen in evangelischen Einrichtungen am Ende ihres Lebens ärztliche Hilfe beim Suizid in Anspruch nehmen können.
Auch Christen können bei solchen komplexen Fragen meist keine einfache Antwort aus dem Hut zaubern. Wir müssen uns solchen Fragen stellen und versuchen, unsere christliche Grundüberzeugung in die heutige Zeit umzusetzen.
Politik und Religion
Ist die Frage, die Jesus da gestellt wird, eigentlich ein politische Frage oder eine religiöse? Sowohl die Frage selbst als auch die Antwort Jesu machen deutlich, dass es natürlich um beides geht. Christen sind Staatsbürger wie alle anderen und die Frage nach dem Verhältnis zwischen Staat und Bürgern stellt sich heute genauso wie damals.
Die Antwort Jesu macht zunächst einmal deutlich, dass es für ihn eine Trennung von Staat und Religion gibt. In Deutschland hat niemand Nachteile davon, wenn er keiner Religion oder einer nicht-christlichen angehört. Bürgerinnen und Bürger müssen sich lediglich an bestehende Gesetze halten. Wenn es aber zum Konflikt zwischen staatlichen und religiösen Bestimmungen kommt, wird für Christen oder Juden oftmals ihr Glaube den Ausschlag geben. Man darf in Deutschland abtreiben, bestimmte Drogen konsumieren, ins Bordell gehen, eine gleichgeschlechtliche Ehe führen, indirekte Sterbehilfe leisten usw. In wieweit ich das mit meinem Glauben vereinbaren kann, ist steht auf einem anderen Blatt.
Der Silber-Denar, den man Jesus zeigte, war Macht- und Kultsymbol in einem. Der Kaiser wurde darauf nicht nur als Staatslenker gezeigt, sondern auch als „oberster Priester“ bezeichnet. Die Antwort Jesu ist vielleicht so zu verstehen: Der Kaiser kann wohl Steuern verlangen, aber die höchste Autorität hat im Zweifelsfall immer noch Gott.
Erinnern wir uns an die Geschichte von den hebräischen Hebammen, von denen im zweiten Buch Mose die Rede ist (2. Mose 1, 15-21): Sie sollten die männlichen Babys der Israeliten töten, was dem Gebot Gottes klar widersprach. Sie gehorchen damals Gott mehr als dem Pharao, belogen ihn sogar, um Leben zu retten, und wurden von Gott gelobt und belohnt.
Die Hebammen waren geprägt von ihrem Glauben an Gott.
Wie schön wäre es, wenn sich immer mehr Menschen prägen ließen von der Liebe Gottes, um sie an ihre Mitmenschen weitergeben zu können.
Amen.
15. Sonntag nach Trinitatis 2023
Gnade sei mit euch und Friede von dem der da ist, der da war und der da kommt. Amen.
Text: 1. Petrus 5, 1-6
Liebe Leserinnen und Leser,
Anfang nächsten Jahres sind in vielen Evangelischen Landeskirchen Wahlen für die Leitungsgremien vor Ort vorgesehen. Die Menschen, die für vier oder mehr Jahre die Geschicke einer Gemeinde leiten, haben in den unterschiedlichen Kirchen unterschiedliche Namen, aber auch die Aufgaben und Befugnisse sind unterschiedlich. In meiner „neue Heimat“, in der Oldenburgischen Kirche, werden die Gewählten „Gemeindekirchenratsmitglieder“ genannt. Das ist nicht nur ein sehr langer Name, er klingt auch etwas bürokratisch. In unserer früheren Partnergemeinde in Brandenburg nennt man die Mitglieder des Leitungsgremiums „Älteste“ und in „meiner“ alten Gemeinde, in der Rheinischen Kirche, heißen sie Presbyter bzw. Presbyterinnen.
Wenn in unserem heutigen Predigt-Text von den Leitungsstrukturen der frühen christlichen Gemeinden die Rede ist, dann steht da tatsächlich das griechische Wort für Presbyter, was wörtlich übersetzt „Älteste“ bedeutet. Aus dem Zusammenhang heraus wird klar, dass es sich hier nicht um das Alter, sondern um die Funktion handelt. In diesem Sinn hören wir auf Worte aus dem 1. Petrus-Brief. Der Autor schreibt am Ende seiner Ausführungen:
Jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch: Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden.
Entsprechend bitte ich die Jüngeren unter euch: Ordnet euch den Ältesten unter! Für Euch alle aber gilt: Haltet fest an der Demut. Nicht umsonst heißt es in der Schrift: „Den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren.“
Dennis Schröder hat es schon wieder getan, dachte sich so mancher Basketball-Fan beim WM-Spiel Deutschland gegen Slowenien. Wieder einmal hatte sich der Spielmacher mit einem Teamkollegen angelegt: Im ersten Viertel des Spiels geriet er während einer Auszeit mit Daniel Theis aneinander, hitzig diskutierten die beiden, schienen kurz davor, handgreiflich zu werden. Endlich reichte es dem Trainer: „Setzt euch hin!“ Als keiner von beiden reagierten, packte Herbert einen Spieler am rechten Arm und zog ihn in Richtung der Bank. „Fass mich nicht so an, Coach“, zischte der. Aber der Trainer blieb hart. Schröder und Theis durften beide bis zum zweiten Viertel nicht wieder auf das Feld. Sie vertrugen sich dabei, spielten in der zweiten Hälfte sensationell, am Ende wurde Deutschland völlig überraschend Weltmeister.
Die Szene ist für mich ein gutes Beispiel für Führung und Leitung. Während eines Spiels kann man keine langen Diskussionen darüber führen, nach welchem System gespielt werden soll. Da muss jemand entscheiden, Verantwortung übernehmen, das Heft in die Hand nehmen.
 Im Ersten Petrus-Brief geht es genau darum, nämlich um Leitung. Der Autor braucht hier nicht das Bild eines Trainers, sondern ein anderes Bild, das eines Hirten. Die Gemeindeleitung wird aufgefordert: „Leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten!
Im Ersten Petrus-Brief geht es genau darum, nämlich um Leitung. Der Autor braucht hier nicht das Bild eines Trainers, sondern ein anderes Bild, das eines Hirten. Die Gemeindeleitung wird aufgefordert: „Leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten!
Vermutlich ist den meisten unter Ihnen bekannt, dass „Pastor“ soviel wie „Hirte“ bedeutet. Hier aber sind interessanter Weise nicht nur die hauptamtliche Theologen im Blick, sonders die gesamte Leitung der Gemeinde, also Theologen und Nicht-Theologen. Sie alle sollen sich wie gute Hirten verhalten. Das Bild ist uns aus verschiedenen Stellen in der Bibel vertraut. Am bekanntesten ist in dieser Hinsicht vermutlich der 23. Psalm, den wir vorhin zusammen gesprochen haben. Es ist das Bekenntnis: Gott leitet mich wie ein guter Hirte dahin, wo es mir gut geht, manchmal zwar mit sanftem Stab, aber immer in die Richtung, die gut für mich ist.
Hirten haben eine andere Funktion als die Schafe, Schafe wiederum eine andere als der Hütehund. So haben auch alle Gemeindeglieder andere Funktionen, je nach ihren Gaben, aber alle stehen auf einer Stufe, ob PredigerIn der ChorsängerIn, PresbyterIn oder KonfirmandIn. Es kann der Angestellte eines Unternehmens in Sachen geistlicher Kompetenz über seinem Chef stehen, ähnlich, als wenn er der Chef der Freiwilligen Feuerwehr wäre und in einem Notfall dem, der im Berufsleben sein Chef ist, Anweisungen zu geben hätte.
Um leiten zu können, muss man jedoch in jedem Fall über die notwendige Kompetenz verfügen: Sowohl ein Trainer als auch ein Hirte muss von der jeweiligen Sache etwas verstehen. Aber ein Hirte würde einer Basketball-Mannschaft sicher keine guten Ratschläge fürs Viertelfinale geben können, und selbst ein Weltmeister-Trainer wäre damit überfordert, eine Herde von Hunderten von Tieren zu geeigneten Wiesen zu führen.
Manche Kollegen sagen mir, in ihren Presbyterien sollte immer wenigstens ein Jurist sitzen, ein Erzieher vielleicht, seit Neustem ein Fachmann/-frau für Energie, möglichst ein Banker, wenigsten ein Steuerberater.
Das ist alles gut und schön, aber bei der Leitung einer Gemeinde sollte es in erster Linie um etwas Anderes gehen, nämlich um geistliche Kompetenz.
Was aber bedeutet das?
Der Autor des Ersten Petrus-Briefes schreibt an die Hirten der Gemeinde: Seid ein Vorbild für die Herde. Worin sollten sie ein Vorbild sein, wenn nicht darin, den Glauben zu leben, ihr Leben in Beziehung zu Gott zu setzen und sich auseinanderzusetzen mit Fragen des Glaubens und des Zweifels? Worin sollten sie ein Vorbild sein, wenn nicht darin, die Kirche nicht nur als einen Ort zu begreifen, der klimatechnisch saniert werden muss, sondern in dem Menschen miteinander ihren Glauben bekennen, ihre Sorgen und ihre Trauer ausdrücken, aber auch ihr Freude vor Gott bringen können. Geistliche Leitung ist nicht nur ein Job, der einem Posten im Kleintier-Verein vergleichbar ist, so sehr auch das eine wichtige Arbeit ist, sondern es ist Berufung. In diesem Sinn darf sich jeder in einer Gemeinde von Gott berufen fühlen, denn jeder und jede wurde von Gott mit bestimmten geistlichen Gaben ausgestattet. Wenn eine Gemeindeleitung dann noch kompetent ist in Fragen der Finanzen oder des Heizens, umso besser…
Dass eine kompetente Leitung in vielen Lebensbereichen sinnvoll und notwendig ist, auch im Bereich der christlichen Gemeinde, ist unbestritten. Der Autor des Ersten Petrus-Briefes macht aber deutlich, dass solche Leitung immer in Demut geschehen müsse.
Das Wort „Demut“ war bis vor kurzem aus unserer Alltagssprache fast verschwunden. Vor einigen Tagen aber tauchte es im Zusammenhang mit der Flugblatt-Affäre um Hubert Aiwanger wieder auf. Aiwanger wurde vom Bayrischen Ministerpräsidenten aufgefordert, zukünftig Demut und Reue zu zeigen. Was aber ist Demut?
Demut ist laut Wikipedia ein Haltung, kein Gefühl. Dahinter stehe die Bereitschaft zum Dienen und auch die Bereitschaft, sich selbst als eher unwichtig zu betrachten. Demut zähle daher in vielen Religionen zu den wichtigsten Tugenden, nicht nur in der Bibel.
Ob Aiwanger in diesem Sinn demütig war, muss von Anderen und an anderer Stelle entschieden werden. Was aber bedeutet „Demut“ für die christliche Gemeinde?
Demut bedeutet nicht, von Gott „gedemütigt“ zu werden oder sich klein zu machen oder den eigenen Wertes zu leugnen. Demut ist die realistische Selbsteinschätzung des Menschen in seiner Position in der Welt: als kleines Staubkorn im Vergleich mit der Größe Gottes, aber zugleich mit der Würde und dem Wert als Geschöpf und Kind Gottes. Wir dürfen uns seine Liebe, seine Freundlichkeit und seine Güte immer wieder zusprechen lassen, aber uns in Demut nicht mit ihn auf eine Stufe stellen.
In der katholischen Kirche beginnt die Beichte mit dem Kreuzzeichen. Es ist das Vorzeichen, unter das die Beichtenden das eigene Bekenntnis stellen, es ist nämlich das Zeichen der grenzenlosen Liebe Gottes.
Unter dieses Zeichen des Kreuzes dürfen wir unser Leben als christliche Gemeinde stellen, alle, die Leitenden, die Leidenden und alle anderen Kinder Gottes.
Amen.
14. Sonntag nach Trinitatis 2023
Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen.
Text: Lukas 17, 11 – 19
Liebe Leserinnen und Leser,
sicher kennen Sie die Sendung „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch. Es könnte dabei eine ziemlich schwere, eine 250.000 Euro-Frage sein, von wem das folgende Gedicht stammt:
Es fiel ein Tau wohl über Nacht
rings auf die durstig matten Auen,
und früh war in der Sonne Pracht
des Schöpfers Lob und Preis zu schauen.
Ein diamantnes Leuchten sprühte
von Strauch zu Strauch, von Halm zu Halm,
und von Milliarden Perlen glühte
zu ihm empor ein Dankespsalm.
Nun aber sendet Tag und Nacht
der Vater seinen Segen nieder,
und hat der Segen Glück gebracht,
wo bleiben dann die Dankeslieder?
Es hat der Mensch so viel zu sagen,
doch Dank an Gott, den sagt er nicht.
Oh, möchte er den Tau doch fragen,
der lehrte ihn die Dankespflicht.
Selbst der Tau auf dem Gras ist dankbarer als der Mensch, wird durch dieses Gedicht ausgedrückt. Geschrieben hat es niemand anderes als der Erfinder von Winnetou und Old Shatterhand, nämlich Karl May. Vielleicht hat er dabei an die folgende Erzählung aus dem Lukasevangelium gedacht:
Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm zehn Aussätzige entgegen; sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: „Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns!“ Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: „Geht und zeigt euch den Priestern!“
Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus fragte ihn:
„Sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben?“ Dann sagte er zu dem Mann: „Steh auf, du kannst gehen! Dein Glaube hat dich gerettet.“
Werfen wir einen Blick auf die Menschen, die uns hier begegnen. Vielleicht erkennen wir uns an irgendeiner Stelle wieder…
Als erstes begegnet uns eine Gruppe von Menschen, die mit Jesus zusammen auf dem Weg nach Jerusalem ist: Die zwölf Jünger gehören dazu, vielleicht auch noch einige Frauen. Unterwegs führen sie Gespräche über den Glauben, vielleicht auch über die Schwierigkeiten, die man damit haben kann. Das ist ein passendes Bild für eine Gemeinde, ja für die gesamte Kirche: Wir sind gemeinsam auf dem Weg zum Reich Gottes, die einen etwas schneller, die anderen langsamer. Dass dabei heute nur eine verhältnismäßig kleine Schar unterwegs ist, muss uns ebenso wenig entmutigen, wie es damals Jesus entmutigt hat. Kleine Zahlen sind kein Grund, den Mut zu verlieren.

Wichtig ist allein, dass wir zusammen unterwegs sind, bemüht, im Glauben zu wachsen, und für andere da zu sein. Im November finden in vielen Kirchenkreisen Synoden statt. Synode bedeutet auch nichts anderes als „gemeinsamer Weg“.
Für Jesus führt der Weg zwar zunächst ans Kreuz, aber am Ende kommt er an bei Gott, seinem himmlischen Vater.
Daneben ist ein andere Gruppe von Menschen unterwegs, eine Schicksalsgemeinschaft von Aussätzigen, Lepra-Kranken würden wir heute sagen. Bei einer Erkrankung an Lepra sterben die Nerven ab, die Patienten verlieren das Gefühl für Schmerz, verletzen sich unbemerkt und infizieren sich mit lebensgefährlichen Krankheiten. Da sie keine Schmerzen spüren, werden Wunden oft nicht behandelt, und durch Entzündungen können ganze Körperbereiche absterben. Was diese Gruppe zusammenhält ist das gemeinsame Leiden. Leidensgenossen sagen wir, oder wir sprechen von einer Schicksalsgemeinschaft. Wir finden das heute etwa bei Angehörigen von Flugzeugabsturz-Opfern, dass sie noch lange Zeit Kontakt haben, sich immer wieder treffen. Auch Trauergruppen sind hier zu nennen, oder Selbsthilfe-Gruppen von depressiven oder drogenabhängigen Menschen. Man stärkt und stützt sich gegenseitig. Damals trat neben das körperliche Leiden noch die Überzeugung, der Aussatz mache den Erkrankten auch kultisch unrein. Er wurde daher aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und durfte nicht mehr an Gottesdiensten und religiösen Festen teilnehmen.
Als die zehn Männer Jesus sehen, bitten sie ihn indirekt um Heilung. Aber Jesus heilt sie nicht, sondern schickt sie zu den Priestern, die dafür zuständig waren, die Genesung eines ehemals Erkrankten festzustellen. Die Zehn folgen der Aufforderung Jesu und machen sich auf den Weg nach Jerusalem. Das ist mehr als ungewöhnlich und man fragt sich: War das Glaube oder haben die Zehn gedacht: Gehen wir einfach mal, es kann ja nicht schaden? Jedenfalls geschieht die Heilung tatsächlich unterwegs, auf dem gemeinsamen Weg nach Jerusalem. Da, wo sich Menschen auf den Weg machen, wo sie Vertrauen wagen, da kann Heilung geschehen.
Die Zehn sind damit auf dem gleichen Weg wie Jesus, hin nach Jerusalem. Für sie ist es der Anfang eines neuen, geschenkten Lebens, für Jesus der Weg in den Tod. Aber weil Jesus diesen Weg gegangen ist, ist er, bildlich gesprochen, mit uns und bei uns auf allen Leidenswegen, die wir zu gehen haben. Der Weg nach Jerusalem führt Jesus selbst ins Leiden, bis hin in dem Gefühl, von Gott verlassen zu sein.
Auf den ersten Blick erscheint die Reaktion der Männer, die nicht zurückkommen, unverständlich, aber sie waren Jesus vermutlich durchaus dankbar, vielleicht haben Sie später im Tempel sogar ein Dankopfer gebracht. Auf Jesu Wort hin waren sie geheilt worden und waren zu den Priestern gegangen, aber dann war anderes wichtiger für sie: Familie, Arbeit, Freunde, Vergnügen…
Zu der Gruppe der Zehn gehörte auch ein Samaritaner. Das wird erst am Ende klar, denn ausgerechnet er ist es, der zu Jesus zurückkommt und ihm dankt. Die Samaritaner galten bei den Juden als Ketzer, weil sie nur die fünf Bücher Mose als heilige Schriften anerkannten und ihnen der Berg Garizim und nicht der Zion als Ort für die Verehrung Gottes galt. Sie wurden von den frommen Juden verachtet und gemieden.
Warum war es wohl der Samaritaner, der zu Jesus umgekehrte? Der Samaritaner war auch ohne seine Krankheit immer schon ein Außenseiter gewesen. Ob er zurückkam, weil er unter seiner Situation als religiöser Außenseiter besonders gelitten hatte? Jedenfalls kommt er zu Jesus zurück und lobt Gott. Für ihn ist der Dank gegenüber Jesus keine Floskel. Er hat über der Gabe den Geber nicht vergessen. Er hat verstanden, dass Jesus beides schenken will: Heil und Heilung, weil er den ganzen Menschen im Blick hat. Am Ende spricht Jesus ihm den Glauben zu: „Dein Glaube hat dich heil gemacht…“, besser: „Dein Glaube hat dich gerettet…“ Wer Gottes Heil, wer seine Liebe und Güte erfahren hat, der kann nicht kommentarlos zur Tagesordnung übergehen, sondern hat allen Grund zum freudigen und dankbaren Lob Gottes „Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“, singen wir.
Menschen können ein Loblied, einen Choral, auch allein zu Hause unter der Dusche singen, aber was ist das gegen den Gesang einer fröhlichen und dankbaren Gemeinde? Das gemeinsame Singen ist die Antwort der Gemeinde auf die Predigt, es ist Gebet und Dank, dient der Pflege der Gemeinschaft ebenso wie der Verinnerlichung von Glaubensinhalte.
Was noch bleibt ist die Frage an uns hier und heute: Sind nicht zehn gesund geworden? Wo sind die anderen neun? Die Situation erinnert mich an die Frage Gottes an Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Wir müssten uns die Frage vielleicht so stellen lassen:
Wo sind die Jugendlichen? Wo sind die 30 bis 50 jährigen? Wo sind die Männer? Wo sind die jungen Alten?
Die Frage „Wo sind die Anderen?“ darf uns nicht schlafen lassen. Und wir dürfen dabei auch der nicht der Frage ausweichen, ob es nicht vielleicht auch an uns selber liegt, dass viele nicht oder nicht mehr kommen. Liegt es vielleicht auch daran, dass wir uns in dem kleinen bekannten Kreis von aktiven Gemeindegliedern so wohl fühlen und auf andere gar nicht eingestellt und erpicht sind? Die Frage Jesu ist eine Herausforderung, gerade denen nachzugehen, die sich von uns abgewendet haben. Lassen wir sie doch teilhaben an der Freude über unseren Gott!
Amen.
13. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Jesaja 42, 1-7
Liebe Leserinnen und Leser,
in meiner „alten“ Heimat, in Rheinland-Pfalz, fängt morgen nach den Sommerferien die Schule wieder an, hier in Niedersachsen und in vielen anderen Bundesländern ist das schon vor einigen Wochen geschehen, wenige Bundesländer folgen in den nächsten Wochen.
Nach dem Ende der Sommerferien gibt es die wichtigen Einschulungen für die Jüngsten, für Andere das Kennenlernen von weiterführenden Schulen. Fast alle Schülerinnen und Schüler lernen neue Lehrerinnen oder Lehrer kennen, viele müssen sich an neue Gebäude und neue Mitschülerinnen und Mitschüler gewöhnen.
Der Schulalltag ist für die Schülerschaft heute nicht leicht. Eine 35-Stunden-Woche oder gar eine Viertagewoche, wie sie in der Wirtschaft von Manchem angestrebt wird, ist für Schülerinnen und Schüler nicht drin.
In dieser schwierigen Situation sind die Ratschläge von Psychologen gefragt, man hört von Versagensängsten und Selbstmordgefahr. Suizid ist bei Jugendlichen inzwischen die zweithäufigste Todesursache. Nicht wenige Schülerinnen und Schüler greifen zu Pillen oder Drogen.
Ich bin vor einiger Zeit auf die Geschichte von dem verspotteten Lehrer gestoßen, eine Geschichte, die auf die andere Seite hinweist, auf Nöte, Schwierigkeiten und Verzweiflung von Lehrerinnen und Lehrern. Welchem Stress sie ausgesetzt sind, wird in in dem Auszug aus dem Tagebuch eines betroffenen Lehrers angedeutet. Dort heißt es:
„Nachts liege ich in leichtem, oft gestörtem Schlaf, immer gegenwärtig, den Hilferuf meiner Frau zu hören, die ich liebevoll ‚Muttchen‘ nenne. Mit 63 noch den Dienst ausüben, Deutsch, Geschichte, Englisch, fünf Stunden Schlaf erhaschen, Muttchen pflegen, füttern, waschen, kämmen, aufrichten und betten, in den großen Pausen schnell nach ihr sehen. Zehn Jahre, zwölf und fünfzehn Jahre Muttchen pflegen. Seit fünfzehn Jahren wissen: Sie hat MS, die Kinder sind erwachsen, leben auswärts, ich muss Muttchen pflegen. Kurzsichtig, stolperigen Schrittes mit Einkaufsnetzen in die Schule gehen. Gespött der Schüler sein und „Möppi“ heißen. Dies alles tragen in Geduld. Friedfertigen Geistes sein. Im Herzen bluten. Nur noch in Unterstufenklassen unterrichten können, selbst erkranken und sich sorgen, wer dann Muttchen pflegt. Nach kurzer Krankheit den Tod vor Augen, kurz zuvor den letzten Willen äußern, mit Hilfe des Kollegen D. ein Testament aufsetzen, verfügen noch, dass es am Tag vor der Beerdigung durch den Direktor in der Schule vorgelesen werde, und das den folgenden Wortlaut hat:
‚Liebe Schüler, ich war fast vierzig Jahre im Schuldienst tätig und habe mich bemüht, ein guter Lehrer zu sein. Ich war nicht ohne Fehler, und wenn ich einem von Euch Unrecht tat, so bitte ich ihn, mir diese Schwäche nachzusehen. Meine Frau leidet – was Ihr nicht wissen konntet – seit fünfzehn Jahren an multiple Sklerose, und ich habe sie in dieser Zeit ohne fremde Hilfe gepflegt. In den letzten Jahren bin ich Euch in zunehmendem Maße zum Gespött geworden. Ich verlor eine Autorität, die ich nie erstrebt habe, und, was schwerer wiegt, die Würde meiner Person. Versteht daher meine folgende Erklärung nicht als einen Akt der Rache, sondern als eine Entscheidung, die die Selbstachtung mir gebietet: Kein Schüler soll an meiner Beerdigung teilnehmen. Und lernt hieraus, was daraus zu lernen ist. Ich wünsche einem jeden von Euch, dass ihm ein glücklicherer Lebensweg beschieden sein möge als mir, und ich bin einem jeden von Euch freundlich gesinnt. Bernhard F.’“
Vielleicht ist es in manchen anderen Bereichen und Verhältnissen nicht anders, dass die vermeintlich Starken oft auch ganz schwach werden:
– Der Arzt als Starker im Verhältnis zum Patienten und doch schwach, wenn es um seine Ehe und Familie geht;
– Der Polizist als Starker im Verhältnis zum Täter, und schwach wenn seine angeschlagen Gesundheit geht;
– Der Vorgesetzte als Starker im Verhältnis zu seinen Mitarbeiterinnen und voll Angst vor dem Scheitern…
Wir sollten immer versuchen, beide Seiten zu sehen und vielleicht sogar zu verstehen.

Die Geschichte von Bernhard F. ist ein Beispiel für den Umgang mit schwachen und hilflosen Menschen, denen man oft gar nicht ansieht, wie groß ihre Not ist oder gar woher sie stammt. Immer drauf, kein Mitleid, kein Erbarmen, so reagieren Menschen leider nicht selten im Berufsleben, aber nicht nur da.
Ein erster Schritt zur Abhilfe bestände darin, genau hinzusehen und wahrzunehmen, was den Anderen wirklich quält, etwa den Lehrer, der so bedrückt wirkt wie Bernhard F. , der bedrückt ausgesehen haben muss.
Oft sagen Menschen „Ich bin sehr geknickt.“ Sie meinen damit: Ich fühle mich schlecht. Manche Menschen sind aber auch im Hinblick auf ihr ganzes Leben geknickt, haben viele Enttäuschungen erlebt, und sind verzweifelt. Ihnen und uns allen gilt die Zusage Gottes, wie sie im heutigen Predigttext ausgedrückt ist.
Der Text steht im 42. Kapitel des Buches Jesaja. Der Prophet berichtet, dass Gott ihm gesagt habe:
„Hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Er führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung.“
Und Jesaja fährt fort mit dem, was Gott ihm gesagt habe:
„Ich, der HERR, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und, die da sitzen in der Finsternis, aus dem Kerker.“
Das geknickte Rohr wird nicht zerbrechen und der glimmende Docht soll nicht ausgelöscht werden: Hilft uns diese Zusage Gottes? Vermutlich nicht, wenn „Gott“ nur eine leere Worthülse für uns ist.
Wenn Gott aber Bedeutung für unser Leben hat, dann hilft uns dieses Wort sehr wohl: Unser Leben bekommt seinen Wert vor allem dadurch, dass Gott uns zu seinem Gegenüber gemacht hat. Seine Menschwerdung in Jesus Christus macht dies noch einmal deutlich. Wenn wir das akzeptieren, dann ist sein Urteil über unser Leben wichtiger als das von Menschen, dann ist die Zusage seines Trostes wichtiger für uns, als alles Andere.
Geknickte Rohre, d.h. geknickte Menschen, gibt es viele, leider auch „geknickte“ Christinnen und Christen. Enttäuschungen und Niedergeschlagenheit sind aber keine Zeichen der Gottesferne. Gottes Auserwählter, sein Knecht, soll im Namen Gottes gerade für die Geknickten, die zu kurz Gekommenen, Geschundenen und Geschlagenen, die Verlachten und Verspotteten dasein.
Die christliche Kirche hat immer wieder deutlich gemacht, dass ein Knecht Gottes, wie er im Predigttext erwähnt ist, in der Gestalt Jesu Mensch geworden ist. Er ist der Gottesknecht schlechthin. Jesus war für die Verspotteten, Leidenden und Ausgestoßenen da, ja, er wurde selbst einer von ihnen. Er ist damit ein Vorbild für uns, ein Anreiz, es ihm gleichzutun.
Gott ist für uns da, wenn wir „geknickt“ sind, aber auch für die Anderen, die vielleicht noch trauriger oder enttäuschter sind als wir. Deshalb dürfen wir nicht nur andere Menschen auf Jesus hinweisen, sondern dürfen ihn als Vorbild nehmen und zu seinem Werkzeug werden, um unsererseits „geknickte Rohre“ zu schützen und zu stützen und glimmende Dochte nicht auszulöschen, sondern sie neu zu entfachen.
Dazu gebe Gott uns Kraft, Mut und Fantasie.
Amen.
12. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Psalm 37, 1-7 i. A
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn man in der Bibel einen bestimmten Psalm finden möchte, gibt es einen einfachen Trick: Man versucht einfach, die Bibel genau in der Mitte zu öffnen. Wenn Sie möchten, können Sie das zu Hause einmal ausprobieren. Es klappt auf diese Weise fast immer, das Buch der Psalmen zu finden. Dann den entsprechenden Psalm aufzuspüren, ist kein Problem.
Die Psalmen stehen m. E. zu Recht an dieser zentralen Stelle, denn sie haben für unseren Glauben eine ganz besondere Bedeutung. Das wird zum Beispiel dadurch sichtbar, dass viele Übersetzungen des Neuen Testamentes die Psalmen als einzige Texte aus dem Alten Testament mit aufführen.
Heute sollen uns Verse aus dem 37. Psalm begleiten. Er beginnt mit den Worten:
Krieg keinen Hals auf die dämlichen Täter
und keinen Neid! Denn du weißt doch längst:
Später welken Sie, Blumen gleich, die ohne Wasser,
vertrocknen wie Gras, aber nur noch viel krasser.
Vermutlich kommt Ihnen das seltsam vor, und in der Tat, es ist die Übertragung des 37. Psalms in heutige Sprache, überschrieben: „Ohne Gott ist alles Schrott.“
Wer es mag, kann sich gerne auf eine solche Sprache einlassen, vielleicht hilft sie dem ein oder anderen zu einem besseren Verständnis des Textes. Mir ist allerdings die vertraue Luthersprache lieber, und das klingt dann so:
Entrüste dich nicht über die Bösen,
und sei nicht neidisch auf die Übeltäter
Wie das Gras werden sie bald verdorren,
und wie das grüne Kraut werden sie verwelken.
Habe deine Lust am HERRN;
der wird dir geben, was dein Herz wünscht.
Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird’s wohlmachen.

Drei Ratschlägen werden uns im ersten Teil des 37. Psalms gegeben. Zunächst wird den Gläubigen geraten, sich nicht aufzuregen und über Menschen zu entrüsten, die offensichtlich Böses und Übles tun. Das ist ein guter und nachvollziehbarer Rat, wenn es etwa darum geht, dass die Nachbarn den Garten verkommen lassen oder die Flüchtlingsfamilie von nebenan die Musik zu laut aufdreht. Hier lohnt sich keine Aufregung, keine Entrüstung, eher ein Gespräch mit den Betroffenen.
Aber es gibt Situationen, in denen Menschen sich zu Recht entrüsten. Wo Menschen vor laufender Kamera Journalisten den Kopf abschlagen, Klosterschulen überfallen werden oder der russischen Agitator Kinder verschleppt und zehntausendfach Kriegsverbrechen begeht, da steigen Zorn und Entrüstung in mir auf. Als eigentlich friedliebender Mensch kann ich nicht anders, als in solchen Fällen auch Gewalt gegenüber solchen Verbrechern gutzuheißen.
Der Psalmist würde mir vielleicht sagen: Sei nicht wütend und aufgebracht, auch wenn das noch so verständlich ist. Natürlich nagt und zerrt es an deinen Nerven, dass manche Menschen keinerlei Rücksicht nehmen, weder auf Gesetze, noch auf Moral, noch auf Frauen oder Kinder, nicht einmal auf ihr Gewissen, wenn sie denn eines haben sollten. Aber das Leben eines Menschen ist von seinem Ende her zu betrachten und zu beurteilen. Die entscheidenden Momente deines Lebens sind Geburt und Tod. Deine Geburt ist das große Geschenk Gottes an dich. Im Laufe deines Lebens wird sich zeigen, was du aus diesem Geschenk machst. Am Ende stellt sich die entscheidende Frage, ob du das Geschenk Gottes angenommen hast und nach seinen Worten und Weisungen gelebt hast oder nicht. Wer das Geschenk des Lebens verachtet und sich nicht nach Gottes geboten richtet, da ist sich der Psalmist klar, der wird am Ende vor Gott nicht bestehen können.
Der zweite Ratschlag des Psalmisten lautet, sich häufiger über Gottes Freundlichkeit und Liebe zu freuen. Wir sind es meist nicht gewohnt, im Zusammenhang mit unserem Glauben von Freude zu sprechen oder gar Lust zu empfinden. Warum eigentlich nicht? Manchmal sind es schon Kleinigkeiten, die uns erfreuen, die manchmal einen ganzen Tag in ein helles Licht stellen, oft sogar Tage oder Wochen. Das kann ein nettes und freundliches Gespräch mit der Nachbarin sein, der Anruf der Enkelin oder ein paar Blümchen, die uns ein Bekannter heimlich vor die Tür gestellt hat.
Wenn schon solche kleinen Dinge uns fröhlich machen, sollte es da nicht eine Freude, eine Lust sein, dass Gott uns liebt, dass er uns das Leben gegeben und in der Taufe „ja“ zu uns gesagt hat?! Dass er deutlich macht: „Du musst dich nicht abrackern, Du musst nicht fehlerlos sein, nein, ich akzeptiere dich so, wie du bist…“
Es gibt Menschen, die haben in ihrem Alltag nur wenig Wünsche, vermutlich eine Frage der Persönlichkeit. Aber ich glaube, jeder Mensch trägt in seinem Inneren den Wunsch, dass sein Leben gelingt, dass er Zufriedenheit erlangt und dass er seinem Ende gelassen und dankbar entgegengehen kann. Christinnen und Christen dürfen voll Freude an Gott glauben, weil er uns genau das geben will, was wir im Innersten wünschen, nämlich das Wissen darum, in Zeit und Ewigkeit in ihm geborgen und aufgehoben zu sein.
Kennen Sie jemanden, der uns mehr zu bieten hätte?
Am Ende der dritte Ratschlag, in der bekannten Formulierung Martin Luthers::
Befiehl dem HERRN deine Wege
und hoffe auf ihn, er wird’s wohlmachen.
Der 37. Psalm ist ein Vertrauenspsalm. Er ruft uns auf: Vertraue Gott auf all deinen Wegen, lass ihn mitgehen, besser noch: vorangehen. Andere Christenmenschen gehen diesen Weg mit mir, manche weisen mir die Richtung, manche stützen mich und anderen kann ich auf ihrem Weg ein kleine Hilfe sein. Immer aber ist es mein Weg, den ich zu gehen habe, für den ich allein die Verantwortung trage. Gerade auf ungewissen Wegstrecken darf ich mich dabei Gott anvertrauen. Seine Gegenwart und Führung können mir ein Stück Gelassenheit, Sicherheit und Ruhe geben.
Christenmenschen wissen, dass sie nicht aus der Hand Gottes fallen können. Vielleicht werden sie auf ihrem Weg hin und wieder stolpern, vielleicht stehen bleiben müssen, vielleicht auch einmal ein Stück zurückgehen müssen. Immer aber sind wir von der Hand Gottes gehalten, der sie niemals allein lässt.
Unsere Glauben gibt und die feste Hoffnung und Gewissheit, dass Gott unserm Leben einen Sinn gibt, dass wir unser Leben meistern können, und dass er uns vor Verzweiflung bewahrt. Vor allem aber hoffen wir, dass er unser Leben am Ende annimmt, nicht wegen unserer Taten, sondern allein aus Gnade und Barmherzigkeit.
Wer am Ende seines Lebens sagen kann: „Gott hat es in meinem Leben wohlgemacht, und wird es auch über dieses Leben hinaus wohlmachen“, der glaubt ganz fest daran, dass Gott in Text und Ewigkeit alles zu unserem Besten tun wird. Das gilt auch von dem letzten Weg unseres Lebens. Wir wissen nicht, wie das aussehen wird, aber die Hoffnung bleibt, dass Gott es auch in dieser Hinsicht wohlfachen wird. Das ist mein Trost, der Heidelberger Katechismus sagt sogar:
„Das ist mein einziger Trost, dass ich mit Leib und Seele,
im Leben und im Sterben,
nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland
Jesus Christus gehöre. Er … bewahrt mich so,
dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel
kein Haar von meinem Haupt kann fallen,
Darum macht er mich auch
durch seinen Heiligen Geist
des ewigen Lebens gewiß
und von Herzen willig und bereit,
ihm forthin zu leben.“
Amen.
11. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Lukas 7, 36-50
Liebe Leserinnen und Leser,
„Ich glaube an Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
geboren von der Jungfrau Maria,
gesalbt und liebkost von Maria aus Magdala,
gelitten unter Pontius Pilatus…“
Ein verwunderlicher Text, sicher auch ein ungewöhnlicher, aber ist es deshalb auch ein unpassender Text?
Der Evangelist Lukas berichtet im 7. Kapsel seien Evangeliums Folgendes:
Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen, und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Gefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Weinen aus; dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl.
Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er: „Wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt; er wüsste, was für eine sündige Person das ist.“ Da wandte sich Jesus zu ihm und sagte: „Simon, ich habe dir etwas zu sagen: Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm fünfhundert Denare, der andere fünfzig. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du: Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden?“
Simon antwortete: „Ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat.“ Jesus antwortete: „Richtig, Simon, und siehst du auch diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht; sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben; sie aber hat nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig.“
Und zu der Frau sagte Jesus: „Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden!“
Durch die Geschichte wird uns klar gemacht, dass Jesus auch für die Menschen da sein wollte, die nicht den gängigen Vorstellungen von einem „anständigen“ Leben entsprachen. Das Außergewöhnliche an dieser Geschichte ist, dass Jesus nicht herablassend, nicht vorwurfsvoll, sondern mit großem Feingefühl und sehr liebevoll redet. Außergewöhnliche ist auch, dass er die Frau ernst nimmt, und dass er die körperliche Nähe einer vermeintlichen Prostituierten zulässt. Außergewöhnlich ist nicht zuletzt die Tatsache, dass dieser Frau ihre Schuld vergeben wird, aber dass auch der Pharisäer Simon nicht beschämt wird. Jesus nimmt auch ihn ernst. Durch das Gleichnis und durch die Frage Jesu, wer von den beiden Schuldnern wohl dankbarer sei, lässt er den Pharisäer die richtige Antwort selbst geben: „Der, dem er die größere Schuld erlassen hat.“
Und wie ist um uns selber bestellt? Gleichen wir einer der beiden Personen, der Frau oder dem Pharisäer? Oder steckt von beiden etwas in uns?
Viele Menschen machen große Unterschiede zwischen den „anständigen“ und den „weniger anständigen“ Menschen. Dabei müsste es Christinnen und Christen klar sein, dass alle Menschen nur „aus dem Glauben heraus“ gerecht werden können, eine der Grunderkenntnisse der Reformation. Aber in der Praxis sieht das oft anders aus. Da gibt es die „kleinen Sünderlein“, bei denen wir bereitwillig eingestehen, auch dazuzugehören, und die anderen, die wirklich Bösen und Schlechten.
Dabei könnte man die Frage stellen, ob unsere vermeintlich kleinen Sünden wirklich so harmlos sind, wie wir meinen. Zu schnelles Fahren: ein Kavaliersdelikt, sagen wir, was aber wenn ein Mensch dadurch zu Schaden kommt? Und der kleine Versicherungsbetrug, die Steuerhinterziehung, die Schwarzarbeit, da käme schon Einiges zusammen…
Reinhard Mey schrieb und sang vor vielen Jahren:
Du hast nicht gestohlen, nicht betrogen,
Und wenn irgendmöglich nicht gelogen,
Oder wenn, dann ist das wenigstens schon eine ganze Weile her.
Hast fast nie nach fremdem Gut getrachtet,
Und fast immer das Gesetz geachtet,
Aber deine Ruhe findest du trotz alledem nicht mehr.
Und auch die Frage könnten wir uns selbstkritisch stellen: Wer ist wohl schuldiger, wer nichts dagegen unternimmt, dass auf dieser Welt in jeder Stunde Hunderte Kinder verhungern, oder der, der in einer bierseligen Nacht einmal über die Stränge schlägt. Auch dazu hat Reinhard Mey ein Meinung:
Mich zu verteid’gen brauch nicht.
Keine Geschwor’nen, kein Gericht
Nehmen mir meine Zweifel ab,
Ob ich dem, der um Hilfe bat,
Was ich ihm geben konnte, gab,
Was ich für ihn tun konnte, tat…
Jesus sagt übrigens nicht, dass es egal oder gar gut sei, wie die Frau ihr Leben führt. Aber er spürt, dass sie von ihm und von der Liebe Gottes, die er ja verkörpert, angetan ist, begeistert ist. Und so tut sie Jesus etwas Gutes, erweist ihm einen „Liebesdienst“, wie wir sagen. Und wem täte das nicht gut, eine Tasse Kaffe angeboten zu bekommen, eine kleine Stärkung zu erhalten, ein aufmunterndes Wort zugesprochen zu bekommen, gerade dann, wenn man sonst selber ständig geben muss und anderen Menschen Mut zuzusprechen hat.

Die Frau liebt den, der ihr die Schuld vergeben kann. Und Liebe deckt alle Schuld zu, denn das höchste Gebot lautet, Gott und die Menschen zu lieben.
Jesus lässt die Nähe der Frau zu, sie ist ihm nicht peinlich, er hat offensichtlich keine schlechten Hintergedanken, wie vermutlich viele der Männer, die die Nase über sie rümpfen und die vielleicht selber im Schatten der Nacht ihre „Kunden“ sind.
Was mag aus der Frau später geworden sein nach ihrer Begegnung mit Jesus?
War sie wirklich eine Prostituierte, wie hätte sie dann weiterleben können ohne diese Beschäftigung? Diesen Beruf haben Frauen damals oft als letzte Möglichkeit ergriffen, ihr Überleben zu gewährleisten, etwa nach dem Tod des Ehemannes.
Wichtiger, als darüber zu spekulieren, wie es mit der Frau weitergegangen sein mag, ist die Frage, was wir aus der Geschichte mitnehmen. Vielleicht diese drei Anstöße:
– Lass keinen Menschen links liegen, wie groß seine Schuld in Deinen Augen auch sein mag.
– Lass Dich anstecken von der ungewöhnlichen Liebe Jesu!
– Lass Dich selbst immer wieder einladen, die Liebe unseres Gottes zu erfahren, die in Christus lebendig geworden ist.
Amen.
10. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Psalm 46 i. A.
Liebe Leserinnen und Leser,
in meiner Münzsammlung, in der sich kleine Geldstücke aus verschiedenen Ländern befinden, ist auch ein Geldstück aus den USA, ein viertel Dollar. Die Münze ist nicht sehr viel wert, und dass ich davon berichte, hängt nicht mit ihrem Gegenwert in Euro zusammen. Interessant ist das Geldstück deshalb, weil auf ihm die Worte stehen „In God we trust.“, d. h. „Wir vertrauen auf Gott.“
Nicht nur auf Münzen, auch auf jedem amerikanischen Geldschein sind diese Worte aufgedruckt
Ich find es schon erstaunlich, dass solche Worte gerade auf Geldscheinen und Geldstücken zu sehen sind, denn viele Menschen vertrauen in ihrem Leben tatsächlich viel lieber dem Geld als Gott.

Das Wort „glauben“ bedeutet im Grunde ja nichts anderes als „vertrauen“. Von daher stellt sich für uns Christenmenschen immer wieder die Frage: Wem oder auf was vertrauen wir?
In der Heiligen Schrift finden wir im Psalter den 46. Psalm. Darin macht ein Mensch deutlich, wem er in seinem Leben vertraut, an wen er glaubt. Er schreibt:
Gott ist für uns Zuflucht und Schutz, in Zeiten der Not schenkt er uns seine Hilfe mehr als genug. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde bebt und wankt und die Berge mitten ins Meer sinken, wenn auch seine Wellen brausen und tosen und die Berge erbeben von seiner gewaltigen Kraft. Der allmächtige HERR ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg. Kommt und führt euch vor Augen, welch große Taten der HERR vollbracht hat! Erkennt, dass ich allein Gott bin, hoch erhaben über alle Völker, geehrt in aller Welt. Der allmächtige HERR ist mit uns, der Gott Jakobs ist für uns eine sichere Burg.
Für den Psalmbeter ist Gott also wie eine Burg, und zwar nicht wie irgendeine beliebige Burg, sondern er ist für ihn wie eine sichere Burg. Burgen hatten früher eine lebenswichtige Bedeutung: Wenn etwa kriegerische Banden eine Gegend überfielen oder Raubritter oder gar ein ganzes Heer, gab es nur einen sicheren Ort, wo man Zuflucht finden konnte: die nächste zu erreichende Burg. Hier war man geborgen, man war gerettet, konnte oft nicht nur die Familie sondern auch einen Teil des Besitzes, etwa Vieh, mitnehmen.

Daran denkt wohl der Psalmbeter, wenn er schreibt, Gott sei für ihn wie eine Burg, Gott sei nämlich das Sicherste, was er habe. Alles im Leben könne ihn enttäuschen, nur nicht Gott.
Es ist sicher kein Zufall, dass Martin Luther diesen von tiefem Vertrauen geprägten Glaubenspsalm nachgedichtet hat, möglicherweise stammt auch die dazugehörige Melodie von ihm. Wir kennen das Lied, das auch heute noch in vielen Kirchen am Reformationstag gesungen wird:
Ein feste Burg ist unser Gott,
ein gute Wehr und Waffen.
Er hilft uns frei aus aller Not,
die uns jetzt hat betroffen.
In diesem Lied geht es natürlicher Weise auch darum, wem wir vertraut können und wollen.
Es ist sicher gut, wenn der, dem wir unser Vertrauen schenken möchten, Qualitäten besitzt wie eine feste Burg:
– dass er uns Schutz bietet gegenüber feindlichen Angriffen,
– dass er uns Geborgenheit und Sicherheit geben kann,
– dass er uns wenn nötig die Angst nehmen kann vor alle was uns bedroht.
Kommen wir noch einmal auf die Frage zurück: In welcher Burg, bildlich gesprochen, fühlen wir uns geborgen? Welchem Burgherren vertrauen wir uns an? Dem aus Martin Luthers Kirchenlied bzw. dem des 46. Psalms oder anderen Burgherren wie Geld, Karriere, Macht, Einfluss oder Ansehen? Setzen wir unser Vertrauen auf Besitz, Grund und Boden, Eigenheim und Aktienpakete- oder auf Gott?
Einige Jahre nach dem 1. Weltkrieg kam es zu einer weltweiten Wirtschaftskrise, in deren Folge die Währung total zusammenbrach. Als man 1923 eine Aktentasche voll Geld brauchte, um ein Brot zu kaufen, ging das Gerücht um, der alte Eintausend-Reichsmark-Schein würde nach einer Währungsreform seinen Wert behalten. Diese Hoffnung trog natürlich, die Scheine verloren ohne Ausnahme ihren Wert. Das Vertrauen ins Geld war in vielfacher Weise enttäuscht worden.
Können wir aber auf der anderen Seite eine Garantie abgeben, dass es beim Vertrauen zu Gott immer gut geht? Gewiss nicht. Vertrauen auf Gott muss ausprobiert werden, erfahren werden, nicht immer gelingt es.
Dass es aber immer wieder gelingen kann, davon legen viele Menschen Zeugnis ab: solche von früher und solche von heute, Männer und Frauen, Alte und Junge.
An einer kleinen Geschichte wird deutlich, was es heißt, auf Gott vertrauen zu können: Ein kleines Mädchen und ihr Vater wollten eine Brücke überqueren. Da bemerkte der Vater, dass seine Tochter vor Angst zitterte, denn die Brücke war sehr hoch. Da meinte der Vater zu ihr „halte meine Hand, dann kann Dir nichts passieren“.
Sie antwortete ihm: „Nein Papa, halte Du lieber meine Hand“. Ihr Vater war etwas verwundert und fragte: „Aber wo ist da der Unterschied?“
Das kleine Mädchen antwortete: „Weißt Du Papa, wenn ich Deine Hand halte, dann kann vielleicht etwas passieren und ich könnte Deine Hand loslassen. Aber wenn Du meine Hand nimmst, dann weiß ich einfach, dass Du sie nie loslassen würdest. Egal was auch passiert!“
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Amen.
9. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Matthäus 7, 24 – 27
Liebe Leserinnen und Leser,
in den Medien liefert man uns immer wieder Bilder von einstürzenden Gebäuden. Es bewegt die Menschen offenbar, wenn Gebilde, die gewöhnlich Schutz und Geborgenheit gewähren, zerstört werden. Die Gründe können dabei ganz unterschiedlich sein: Terror, Sprengungen oder Starkregen, wodurch Häuser nicht nur unterspült, sondern manchmal sogar weggespült werden. In letzteren Fall hätte eine Katastrophe oft verhindert werden können, wenn die betreffenden Gebäude einen festen Untergrund, ein starkes Fundament gehabt hätten.
Jesus gebraucht in einem seiner Gleichnisse ähnliche Bilder, um auf das Fundament unseres Lebens hinzuweisen. Im Matthäusevangelium heißt es:
diese Bilder Naturkatastrophen sind eine makabre Illustration und furchtbares Anschauungsmaterial für ein Gleichnis, das Jesus einmal seinen Zuhörerinnen und Zuhörern erzählt hat und das Predigttext für den heutigen Sonntag ist. Jesus spricht darin aber nicht von einer Umweltkatastrophe oder von einem terroristischen Anschlag, er redet vom Glauben. Das erwähnte Gleichnis steht am Ende der Bergpredigt. Jesus schließt sie mit den Worten ab:
Jeder, der meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein.
Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört.
Dieses Gleichnis steht am Ende der Bergpredigt. Viele Worte bzw. Abschnitte daraus sind sehr bekannt, z.B. die Seligpreisungen, das Gebot seinen Mitmenschen zu lieben oder das Vaterunser. Am findet sich dann die Warnung, diese Worte nicht unbeachtet zu lassen: Ein kluger Mensch, der die Worte Jesu höre und danach handele, sei wie einer, der sein Haus auf Felsen baue. Ein törichter Mensch, der die Worte Jesu zwar höre, sich aber nicht nach ihnen richte, sei wie einer, der sein Haus auf Sand baue.
Die Stürme und Wasserfluten, die Häuser aus zum Einsturz bringen können, kennen wir zu Genüge, entsprechende Bilder erreichen uns immer öfter. Was aber sind es für Stürme, die das Haus unseres Lebens und zum Einsturz bringen könnten? Vielleicht eine schwere Krankheit, der Verlust des Arbeitsplatzes, eine tragische Trennung, ein Unfall…
Aber was ist letztlich das Fundament, das solchen Stürmen standhalten kann, gerade dann, wenn kein anderer mehr helfen kann? Wer sagt dem Menschen, worauf er sein Leben gründen kann?

Wir bekommen heute Lebenshilfen frei Haus oder frei Internet: wie ich mich richtig ernähre, wie ich meinen Garten am besten anlege, Tipps in Sachen Sex, Energie und Geld… , was aber ist mit dem Fundament?
Martin Luther verließ sich auf das Wissen: „Ich bin getauft!“ Er war bei der Taufe einen Tag alt, konnte nichts mitbekommen von dem, was da vor sich ging. Aber er verließ sich ein Leben lang darauf. Er verließ sich nicht auf das, was er als richtig erkannt hatte, nicht auf seine Intelligenz oder seine theologische Weitsicht, auch nicht auf die Kraft seines Wortes, seiner Rede. Er verließ sich auf das, was für ihn mehr Bedeutung und Gewicht hatte: Er verließ sich auf Gottes Zusage! Denn wenn auch alles andere wie Sand zerlaufen würde, wenn alles andere unter den Stürmen des Lebens zusammenbrechen würde, so bliebe doch die Zusage Gottes wie ein Felsen, wie ein steinernes Fundament, unverrückbar stehen.
Was könnte diese Zusage Gottes heutigen Menschen in Krisensituationen sagen?
Du, Mensch der du keine Arbeit findest, du bist nicht wertlos. Du hast einen Wert bei Gott. Selbst wenn Menschen nichts für dich tun können, für mich bist du wichtig. Das gibt dir Selbstvertrauen und Zuversicht, es lässt dich nicht verzweifeln, nicht zuschanden werden…
Du, Junge, mit der fünf in Mathe, das ist nicht gut. Vielleicht fragst du mal jemanden, der dir die ganze Sache noch mal erklärt und vielleicht solltest du auch ein bisschen fleißiger sein. Aber ich habe dich lieb, auch wenn deine Eltern schimpfen und enttäuscht sind.
Du, Mädchen, fast alle dein Träume sind zerbrochen. Worte können das nicht so schnell heilen. Aber du darfst wissen, dass du mir alle deine Tränen bringen darfst. Und das dein Leben nicht sinnlos ist, auch wenn es jetzt so aussehen mag. Du kannst aus diesem Leben etwas machen, weil du wissen darfst, dass ich dich liebe und dir gerade im Leiden nahe sein will.
Der Apostel Paulis drückt das im 1. Korintherbrief so aus:
Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus.
So gut ein festes und stabiles Fundament ist, und so schön es ist, wenn Gott es uns umsonst schenkt, auf dem Fundament des Glaubens muss ja nun gebaut werden. Gott schenkt dem Menschen Gaben, die er für Andere einsetzten soll- und natürlich auch für sein eigenes Lebensgebäude.
Ein Fundament für sich allein macht auch wenig Sinn. Ist es vorstellbar, auf dem Fundament des Glaubens nicht weiterzubauen? Ist es vorstellbar, das Wort Jesu zu hören und nicht danach zu handeln? Was würde man von einem Menschen denken, der ein gutes festes Fundament errichtet hätte und ließe es über Jahre hinweg nutzlos daliegen, vielleicht sein ganzes Leben lang?!
Gott bietet uns das Fundament des Lebens an. Wir können es links liegen lassen und abseits davon unser Haus errichten. Jesus aber lädt immer wieder ein, auf dem vorhandenen Fundament zu weiter zu bauen, vielleicht schiefe und wacklige Wände, vielleicht einzelne Mauerstücke, die wieder abgerissen und neu gebaut werden müssen. Aber ein Gebäude, das auf einem solchen Fundament gegründet ist, wird nicht ins Wanken kommen, wie groß die Stürme des Lebens auch sein mögen.
Bei gutem Wetter bleibt jedes Haus stehen, bei schlechtem Wetter aber kann ein Haus ohne Fundament einstürzen. Wenn keine Probleme, Ängste, Nöte und Sorgen vorhanden sind, sind Glaube und Unglaube nach außen hin schwer zu unterscheiden. In den Krisensituationen des Lebens aber kann der Glaube dem Menschen Halt geben, aus dem heraus er sein Leben wieder weiter führen kann, und aus dem heraus er ein Lebensgebäude errichten kann, dem kein Sturm etwas anhaben kann.
Amen.
8. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Matthäus 20, 1-15
Liebe Leserinnen und Leser,
als ich das letzte Mal über den heutigen Predigttext gesprochen habe, wurde ich nach dem Gottesdienst von einem Gemeindeglied zur Rede gestellt: Der Text sei ja absolut unmöglich, was sich Jesu dabei wohl gedacht habe, mit Gerechtigkeit habe das doch wohl nichts zu tun. Vermutlich war es mir in der Predigt nicht gelungen, deutlich zu machen, worum es in dem Text eigentlich geht. Vielleicht gelingt es mir ja heute, wenn nicht, dürfen sie mich nach dem Gottesdienst gern darauf ansprechen.
Aber hören wir zunächst auf den Predigttext. Wir kennen ihn vielleicht unter dem Namen „Die Arbeiter im Weinberg“. Jesus beginnt sein Gleichnis mit den Worten:
Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg…
Das klingt sehr schön, nur leider versteht man den Text nicht wirklich gut: Was ist ein Silbergroschen, was ein Tagelöhner? Ich greife daher zum besseren Verständnis ausnahmsweise zu der so genannten Volx-Bibel, in der das Gleichnis Jesu wie folgt übersetzt übertragen wird:
Es war einmal ein Bauunternehmer, der hatte eine große Baustelle in der Innenstadt. Morgens ging er zum Arbeitsamt, um ein paar Arbeiter für den Bau anzustellen. Er handelte mit den Männern die Kohle aus, die sie für die Arbeit kriegen sollten, 13 Euro die Stunde, etwas über dem Mindestlohn, ein Stunde Pause.
Um 9:00 Uhr fingen sie an, zu arbeiten. Ein paar Stunden später ging der Unternehmer noch mal zum Arbeitsamt und sah noch ein paar Leute rumstehen, die keinen Job hatten. Die schickte er auch auf die Baustelle und versprach ihnen eine gerechte Bezahlung. Als er gegen 17:00 Uhr beim Hauptbahnhof vorbeikam, sah er da auch noch ein paar Leute rumstehen und fragte sie: „Haben Sie heute keine Arbeit gefunden?“ „Keiner hatte einen Job für uns“, sagten sie. Da rief er ihnen zu: „Wenn Sie wollen, können Sie heute noch auf meiner Baustelle arbeiten!“
Um 18:00 Uhr sagte er zum Personal-Chef: „Rufen Sie die Leute zusammen und zahlen Sie ihnen ihren Lohn.“
Zuerst bekamen die Leute ihr Geld, die erst um 17:00 Uhr angefangen hatten, 104 Euro. Die waren sehr überrascht, als man ihnen den vollen Tageslohn für acht Stunden Arbeit gab.
Inzwischen hatten sich die anderen Arbeiter die Sache durchgerechnet und dachten, sie würden noch viel mehr abkassieren, als sie vereinbart hatten. Aber sie bekamen auch den Tageslohn, den sie ausgehandelt hatten.
Da wurden sie sauer und meinten: „Die da haben nur ’ne Stunde gearbeitet und kriegen dieselbe Kohle wie wir? Dabei mussten wir den ganzen Tag in der Hitze malochen!“
„Entspannen Sie sich!“, sagte der Chef, „Es läuft hier alles korrekt! Wir hatten genau diesen Lohn miteinander ausgehandelt, oder?! Nehmen Sie also das Geld und gehen! Ich gebe den Anderen genauso viel Lohn wie Ihnen. Immerhin ist es mein Geld, mit dem ich machen kann, was ich will! Oder finden Sie es nicht okay, dass ich großzügig bin?“
Haustarife sind in der Arbeitswelt normalerweise wenig beliebt. Es gibt sie vor allem da, wo Arbeitgeber nicht in der Tarifbindung sind. In der Regel ist das für die Belegschaft weniger günstig, als wenn sie nach Tarif bezahlt würde.
Man könnte sagen, dass der Bauunternehmer in unsrem Gleichnis auch einen ganz eigenen Haustarif hat, aber einen, der in die andere Richtung geht: Alle Arbeiter bekommen den gleichen, fairen Lohn, auch wenn sie nur wenige Stunden am Tag arbeiten.
Ein sozial eingestellter und wohlhabender Unternehmer könnte das eine zeitlang so machen. Es könnte ihm egal sein, wie lange die Einzelnen für ihn arbeiten würden, wenn es ihm nur darum ginge, dass sie genug Geld verdienten, um eine Familie zu ernähren und ein Dach über dem Kopf zu haben. So zu handeln wäre sicher lobenswert, wenn es auch leicht zum Missbrauch verführen könnte. Unsere Volkswirtschaft würde mit einem solchen Modell aber auf jeden Fall nicht funktionieren können.
Also hatte das Gemeindeglied recht, als es das Gleichnis so scharf kritisierte?
Das Gleichnis wäre in der Tat kaum brauchbar, hätte Jesus damit ein neues Tarif- oder Arbeitsrecht einführen wollen. Darum ist es für das Verständnis notwendig, darauf hinzuweisen: Es geht nicht um eine gerechte Tarifpolitik oder um Überlegungen zum Mindestlohn, sondern es geht um das Reich Gottes. Wir erinnern uns an den Beginn in der uns vertrauen Lutherbibel:
Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben.
 Der Hausherr – oder in der modernen Fassung der Bauunternehmer- ist natürlich ein Bild für Gott! Jesus will mit seinem Gleichnis ausdrücken: Wenn es um das Reich Gottes geht, sind wir alle gleichermaßen auf die Gnade Gottes angewiesen, egal wie sehr wir möglicherweise schuldig geworden sind, egal wie lange wir uns schon für ein Leben im Glauben entschieden haben. Im Reich Gottes gilt Gottes Haustarif, und der ist mehr als nur arbeitnehmerfreundlich, er ist menschenfreundlich. Im Verhältnis zu Gott gilt nicht das Leistungsprinzip. Vielmehr handelt Gott nach dem Prinzip der Liebe und Barmherzigkeit. Er fragt, was wir nötig haben, nicht was wir verdient hätten.
Der Hausherr – oder in der modernen Fassung der Bauunternehmer- ist natürlich ein Bild für Gott! Jesus will mit seinem Gleichnis ausdrücken: Wenn es um das Reich Gottes geht, sind wir alle gleichermaßen auf die Gnade Gottes angewiesen, egal wie sehr wir möglicherweise schuldig geworden sind, egal wie lange wir uns schon für ein Leben im Glauben entschieden haben. Im Reich Gottes gilt Gottes Haustarif, und der ist mehr als nur arbeitnehmerfreundlich, er ist menschenfreundlich. Im Verhältnis zu Gott gilt nicht das Leistungsprinzip. Vielmehr handelt Gott nach dem Prinzip der Liebe und Barmherzigkeit. Er fragt, was wir nötig haben, nicht was wir verdient hätten.
Die Kritik am Gleichnis Jesu ist schon in Gleichnis selbst angelegt. Die, die den ganze Tag gearbeitet haben, empfinden den krassen Unterschied im Stundenlohn als Ungleichbehandlung. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das trifft hier nicht zu. Keine Gewerkschaft würde so etwas heute akzeptieren.
Aber auch hier gilt: Es geht nicht darum, wer welchen Lohn erhält, was gerecht ist und was nicht. Dass es sicher nicht gerecht ist, dass mancher nach einem Leben mit schwerer Arbeit am Ende von seiner Rente nicht leben kann, während manche Fußballer ein Jahresgehalt in Millionenhöhe erhalten, liegt auf der Hand. Aber das steht hier nicht zur Debatte. Hier geht es allein um die Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes. „Findet ihr das nicht okay, dass ich großzügig bin?“, hören wir Gott am Ende fragen.“
In den Medien heißt es manchmal, in Deutschland herrsche eine Art Neidkultur. Neidkultur bedeutet, dass man anderen Menschen nichts gönnt, obwohl einem selber dadurch kein Schaden entsteht. Eine solche Haltung ist schon im Alltag nicht besonders schön, im Glauben hat sie erst recht nichts zu suchen. Wenn jemand erst spät in seinem Leben den Weg zum Glauben findet, kann man eigentlich nichts anderes tun, als sich darüber zu freuen, dass er diesen Weg überhaupt noch gefunden hat.
So wie der Bauunternehmer im Gleichnis Jesu Mitarbeiter sucht, so werden auch bei uns in vielen Branchen Arbeitskräfte dringend gesucht. Es wird immer schwieriger Pflegepersonal, Kellner oder Erzieher zu finden, um nur ein paar Beispiel zu nennen. Fachkräftemangel ist das Stichwort.
Auch Gott sucht MitarbeiterInnen in seinem Weinberg: Ich glaube nicht, dass wir die Hände nur in den Schoß legen und daneben nur noch beten sollten. Vielmehr sollten wir beten und das tun, was nötig ist und wozu wir fähig sind.
ArbeiterInnen im Weinberg Gottes sind nicht nur Pfarrerinnen, Missionare und Diakone, sondern jeder Christenmensch sollte ein Arbeiter in Gottes Weinberg sein. Keiner kann alles, aber jeder kann etwas. Das gilt auch im Bereich des Glaubens und der Kirche.
Die Arbeit in Gottes Weinberg ist nicht immer leicht, aber es gibt viele Dinge, die solche Schwierigkeiten aufwiegen:
Wir haben einen guten, zuvorkommenden und gerechten Chef.
Unser Chef kümmert sich um unsere Sorgen und Nöte.
Wir werden nicht verheizt.
Wir bekommen vollen Lohnausgleich, auch wenn wir schwächeln.
Und Nicht zuletzt: Neben die Arbeit treten Ruhe, Entspannung und Erholung, denn unser Chef hat den Sonntag erfunden…
Amen.
7. Sonntag nach Trinitatis 2023,
Text: Apostelgeschichte 2, 41 – 47
Liebe Gemeinde,
nach der Sitzung des Gemeindekirchenrates am Freitag-Abend stehen die Mitglieder noch zusammen im Flur des Gemeindehauses. Es ist wieder einmal fast 23.00 Uhr geworden und erfreuliche Themen hatte es heute auch kaum gegeben. Herrn Meier platzt mit einem Mal der Kragen:
„Ich bin es bald leid!“, sagt er. „Ich habe mich vor drei Jahren mit viel Begeisterung in den Gemeindekirchenrat wählen lassen. Aber was machen wir hier eigentlich? Wir reden über Geld, steigende Energiekosten, Baumaßnahmen und Personal-Probleme: Das nötige Geld fehlt überall, ganze Arbeitsfelder müssen demnächst aufgegeben werden, und unser Pfarrer muss jetzt auch noch die Nachbargemeinde übernehmen. Allein die Umbauten und Reparaturarbeiten an der Kirche nehmen die Hälfte der Sitzungszeit ein, und wenn die Punkte abgehakt sind, kommen auch fast nur noch Probleme zur Sprache: Probleme, die wir mit anderen haben und Probleme, die wir untereinander haben. Was sind wir nur für ein Verein! Ein paar Leute engagieren sich wenigstens noch beim Gemeindefest, aber Feste können andere Vereine genauso gut veranstalten wie wir.“
Frau Bauer, die jüngste in der Runde, meint: „Wir müssen halt mit dem Vorlieb nehmen, was wir haben. In den großen Städten sieht es noch viel schlimmer aus. Und Sport- und Musikvereine haben ganz ähnliche Nachwuchs-Probleme wie wir. Wir müssen froh sein, dass sich überhaupt noch ehrenamtlich Mitarbeitende und einige Gottesdienstbesucherinnen und -besucher finden…“
„Nein, nein!“, protestiert Herr Müller. „Wer mit Ernst ein Christenmensch sein will, der muss sich doch vom durchschnittlichen Bundesbürger unterscheiden. Und das muss sich auch in der Gemeinde widerspiegeln, so wie damals in Jerusalem: Da ist die Gemeinde rasant gewachsen und alle waren gut drauf!“ Wie zum Beweis geht er zurück in den Gemeindesaal und holt eine Bibel aus dem Regal. Er blättert: „Hier ist es ja, in der Apostelgeschichte. Hört mal zu:
‚Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa dreitausend Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde.’
Wenn man das mit unserer Gemeinde vergleicht, da können wir uns ja nur schämen!“, fügt Herr Meier hinzu und schlägt die Bibel mit einem lauten Knall wieder zu.
„Ich glaube“, schaltet sich jetzt die Vikarin ein, „Lukas beschreibt hier eher eine Gemeinde, wie er sie sich gewünscht hätte. Ihr müsst Euch klarmachen, dass Lukas hier ein Idealbild gezeichnet hat. Er hatte gar keine klare Vorstellung mehr von der Situation zur Zeit der ersten Gemeinde. Er hat die Apostelgeschichte fast 40 Jahre später geschrieben als Paulus und in vielen wichtigen Punkten widersprechen sich beide. Lukas will gar keinen genauen Tatsachenbericht geben. Er verkündet in erster Linie die frohe Botschaft, dass Gott den Menschen liebt, und er beschreibt dann, wie ein Gemeindeleben aussehen sollte, das davon geprägt ist. Von daher sind seine Ausführungen wichtig, und wir können uns an ihnen orientieren. Wir sollten uns aber durch die vermeintlichen Erfolgsmeldungen nicht entmutigen lassen.“
Wir verlassen für einen Augenblick die Runde. In der Tat, als Lukas die Apostelgeschichte verfasste, schrieb man das Jahr 90. Zu dieser Zeit waren die Verhältnisse schon lange nicht mehr so, wie zur Zeit der Urgemeinde. Lukas schreibt weitgehend so, wie es seiner Vorstellung von der Verkündigung Jesu entsprach. Darin unterscheidet er sich teilweise auch von den anderen Evangelisten
Das, was in der ersten Jerusalemer Gemeinde passierte, hat man oft mit dem Wort „Liebeskommunismus“ bezeichnet. Nicht alle Gemeindeglieder gingen einer Arbeit nach, und wenn es finanzielle Probleme gab, wurde etwas vom Besitz Einzelner verkauft und das Geld an Alle verteilt. Man brauchte keinen Besitz, denn ma erwartet die unmittelbare Wiederkunft Christi. Damit war die Gemeinde aber bald am Ende, denn bekanntlich traf die Wiederkunft Jesu bis heute noch nicht ein. Am Ende musste Paulus in anderen Gemeinden für die Jerusalemer Gemeinde betteln.
Natürlich sollten wir uns nie damit zufrieden geben, dass Gemeinden schrumpfen und die Kirche für immer weniger Menschen attraktiv ist und dass sie als eine Hilfe zum Glauben und zum Leben immer seltener in Anspruch genommen wird. Aber die Worte der Apostelgeschichte sollten uns nicht entmutigen, sondern ermutigen. Und dazu dient der Hinweis von Lukas, was denn die Gemeinde ausgemacht habe: Gemeinschaft zu pflegen, zusammenstehen, und als Höhepunkt der Gemeinschaft das Abendmahl, in dem es ja nicht nur um die Gemeinschaft untereinander geht. Vielmehr geht es im Abendmahl ja auch darum, die Gemeinschaft mit Christus und seinem himmlischen Vater zu erleben. Wo das erfahren wird, kann Trennendes überwunden werden. Von daher sollten wir es so oft wie möglich am Abendmahl teilnehmen, zumal dies in der Corona-Zeit lange nicht möglich war.
Kehren wir noch einmal zurück zu unserer Gruppe. Mit den Ausführungen der Vikarin sind manche gar nicht einverstanden, im Gegenteil. Das lebhafte Gespräch droht zu einer handfesten Auseinandersetzung auszuarten. Es fallen einig unfreundliche Worte.
Jetzt endlich schaltet sich der Pfarrer ein, aber anders, als man erwartet hatte:
„Es ist spät geworden. Ihr geht jetzt am besten nach Hause. Tut mir aber bitte den Gefallen und kommt am Sonntagmorgen alle in den Gottesdienst.“
Alle sind so gespannt, dass sie zwei Tage später tatsächlich vollzählig im Gottesdienst sitzen. Man merkte, dass der Pfarrer sich darüber freut.
Vielleicht kommt jetzt die Gardinenpredigt wegen des Streites am Freitag oder ein Vortrag über den Rückgang des Kirchenbesuchs? Nichts davon, der Pfarrer sagt nur, dass man in der Kirche die Gemeinschaft nicht hoch genug schätzen könne. War das alles? Einige sind leicht enttäuscht.

Aber dann geschieht doch noch etwas Ungewöhnliches: Nach der Predigt geht der Pfarrer in die Sakristei, holt Brot und Wein, und obwohl es nicht im Gottesdienstplan angekündigt ist, lädt er ein zum Abendmahl. Von Vergebung und Gemeinschaft redet er dabei und dann stimmt er das Lied an:
Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen:
Wir sind, die wir von einem Brote essen,
Aus einem Kelche trinken Jesu Glieder,
Schwestern und Brüder.
Am Ende reichen sich alle die Hände, die Mitglieder des Gemeindekirchenrates und alle, die am Abendmahl teilgenommen haben. Einige stehen zufällig genau neben denjenigen, mit denen sich sich heftig auseinandergesetzt hatten. Und sie alle fühlen in diesem Augenblick: das Abendmahl ist nicht nur für mich selber da, und es wird im Abendmahl nicht nur mir meine Schuld vergeben. Vielmehr sind im Abendmahl alle angesprochen – und plötzlich verliert all das Trennende seine Bedeutung. Und alle fühlen, dass dies ein erster Schritt ist zu einer Gemeinde von Schwestern und Brüdern, die hinauswirken kann in die Welt.
Amen.
6. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Jesaja 43, 1b – 3
Liebe Leserinnen und Leser,
manchmal stelle ich bei Taufgesprächen die Frage, warum die Eltern den Wunsch haben, ihr Kind taufen zu lassen. Hin und wieder kommt dann die Antwort: „Das Kind muss doch einen Namen haben!“ Natürlich haben die Kinder schon einen Namen, wenn sie getauft werden, er muss ja spätestens bei der Anmeldung auf dem Standesamt festgelegt werden. Aber wer so antwortet, der ahnt vielleicht etwas von dem Zusammenhang zwischen der Taufe und der Namensgebung.
In der Tat geht es bei der Taufe ganz wesentlich um Namen. Als Pfarrer frage ich, wie das Kind heißt, dann spreche ich ihm, stellvertretend für Gott, die Worte zu:
„Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen.“
Die Worte stammen aus dem Buch Jesaja, wo um 500 vor Christus ein Prophet seinem Volk die Freundlichkeit und Barmherzigkeit Gottes mit folgenden Worten verkündet:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Wenn du durchs Wasser gehen musst, so wirst du nicht ertrinken und wenn du durchs Feuer gehen musst, so wirst du nicht verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott und dein Retter.
Jeder Mensch in Deutschland hat einen Familiennamen. Früher war es selbstverständlich, dass Vater, Mutter und Kinder den gleichen Familiennamen trugen. Heute ist vieles komplexer geworden: Eltern können Ihren Namen nach der Eheschließung behalten, Doppelnamen sind möglich, aber die Eheleute müssen sich auch heute noch auf einen Familiennamen einigen.
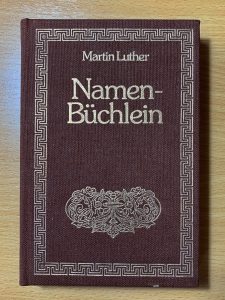
Interessant finde ich es, herauszubekommen, woher der eigene Familienname eigentlich stammt, wie er entstanden ist. Dazu muss man wissen, dass sich die meisten Familiennamen von einer der folgenden vier Gruppen ableitet:
Berufsbezeichnungen (Bauer, Müller, Schneider, Fischer),
Vornamen von Vater oder Mutter (Karlson, Hansen),
Eigenschaften der Vorfahren (Langneese) oder
geographische Herkunft (Berlin, Bonn).
Oft ist es aber für Laien nicht möglich, die Herkunft ihres Familiennamens zu ergründen. Im SWR 1 gab es zu meiner Zeit jeden Tag die Möglichkeit von einem Professor für Namenkunde die Herkunft des eigenen Namens erforschen zu lassen. das geschieht keineswegs aus reiner Neugier. Vielmehr ist es hilfreich zu wissen, wer unsere namensgebenden Vorfahren waren, weil sie uns vermutlich ein Stück weit geprägt haben und wir uns das bewusst machen können.
Eine positive Prägung hat es offenbar in der Familie Bach gegeben, da es dort über die Genrationen hinweg besonders viele ausgezeichnete Musiker und Komponisten gab. Ähnliches könnte man heute über die berühmte Kelly-Family sagen…
Wenn der Nachname also etwas über unsere Vergangenheit aussagt, so ist es mit dem Vornamen genau andersherum. Man bekommt ihn meist von seinen Eltern, und zumindest früher waren Vornamen so etwas wie ein Programm.
Martin Luther King, der Pfarrer, Friedensnobelpreisträger und Bürgerrechtler, trug den Namen Martin Luthers wie eine Überschrift über seinem Leben. Wie schon für seinen Vater war der Name Martin Luther für ihn Ausdruck tiefen religiösen Empfindens. Ursprünglich hieß Kings Vater Michael King und er selbst Michael King Jr. Der Vater änderte beide Namen nach einer Europareise im Jahre 1934, die ihn auch nach Deutschland führte, zu Ehren des Reformators, für den er große Bewunderung empfand. Dieser Namensbestanteil war Programm bei allem, was Martin Luther King jemals tat.
Ein eher tragisches Beispiel war Rainer Maria Rilke. Schon als Kind fand ich den Namen „Maria“ für eine Mann, gelinde gesagt, seltsam. Der berühmte Lyriker wurde als René Maria Rilke 1875 in Prag geboren. Seine Kindheit war unglücklich. Während dem Vater seine angestrebte Karriere nicht gelang, verkraftete die Mutter den frühen Tod der älteren Tochter nicht. Aus Hilflosigkeit band sie ihren einzigen Sohn René – französisch für „der Wiedergeborene“ – an sich und drängte ihn in die Rolle der verstorbenen Schwester und gab ihm deshalb den Namen Maria. Bis zu seinem sechsten Lebensjahr wurde Rilke als Mädchen erzogen, frühe Fotografien zeigen ihn mit langem Haar und im Kleid…
Vornamen können ein Hinweis darauf sein, was für Wünsche oder Erwartungen Eltern bzgl. ihrer Kinder haben. Das gilt oder galt besonders für christliche Vornamen. Was sagen sie aus?
Christian oder Christiane: AnhängerIn Christi
Gabriel: Gott ist meine Stärke.
Emanuel: Gott ist mit uns.
Daniel: Gott ist mein Richter.
Ich freue mich über solche Namen, aber besonders schön ist es, wenn Eltern damit auch noch Inhaltliches verbinden. Für Martin Luther war Vornamen so wichtig, dass er ein eigenes Büchlein darüber herausgab.
Der Vorname kann also so etwas sein wie ein Zukunftsprogramm, eine Wunschvorstellung der Eltern, während der Nachname auf die eigenen Wurzeln verweist. Neben diesen beiden Namen, dem Vor- und dem Nachnamen, ist da aber noch ein dritter Name. Ich rede nicht von Spitznamen oder Kosenamen, die wir natürlich auch noch haben können. Ich meine vielmehr den Namen, den wir bei der Taufe bekommen, sind wir doch im Namen und vor allem auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft:
„Lukas Müller, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
In der Taufe erhalten wir also einen dritten Namen, einen zusätzlichen. Den beiden anderen Namen, Vor- und Nachname, wird der Name Christi wie ein Schutz und zugleich wie eine Ehrenbezeichnung vorangestellt. Dadurch wird deutlich, was Gott dem Getauften vorbehaltlos zusagt:
„Du bist gemeint, ich lade dich persönlich zu mir ein und rufe dich bei deinem Namen. Du bist mir unendlich wichtig, darum fürchte dich nicht, Christenmensch Lukas Müller!“
Der Name „Christenmensch“ oder „Christin“ oder „Christ“ ist ein enorm wichtiger Zusatz, vergleichbar einem Doktortitel, der ja auch fester Bestandteil des Namens ist.
Diese Zusage Gottes ist der Grund, warum wir trotz aller Ungewissheit und Furcht dennoch auf ein in Gott geborgenes Leben hoffen, für uns als Getaufte und für alle, die wir bei der Taufe begleiten.
Die Schwierigkeiten des Lebens sind dadurch nicht ausgeblendet, aber ein Leben an der Seite Gottes wird in dessen Augen am Ende nicht scheitern.
Als Getaufte sind wir Weggefährten Jesu. Und wir haben Schwestern und Brüder, die mit uns unterwegs sind, mit dem gleichen Namen, auf gleicher Straße, mit dem gleichen Ziel. Daraus kann uns immer wieder Mut für ihren Lebensweg erwachsen, immer dann, wenn wir uns an unseren dritten und wichtigsten Namen erinnern.
Amen.
5. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Genesis 12, 1 – 4
Liebe Leserinnen und Leser,
Ferienzeit ist Reisezeit. In einer Reihe von Bundesländern haben die Ferien bereits begonnen und damit rollt die übliche Reisewelle. Am Ende einer Urlaubsreise freut man sich, wenn der Urlaub erholsam war und man erzählt gern von der Gastfreundschaft in anderen Ländern.
Ganz anders sieht es aus, wenn sich Menschen gezwungenermaßen auf die Reise machen müssen. Viele hunderttausend Menschen sind jedes Jahr unterwegs in andere Länder, weil sie es in ihrem eigenen Land nicht mehr aushalten können. Nicht wenige davon kommen auch nach Deutschland. Im Augenblick sind es Menschen aus der Ukraine, die vorübergehend bei uns sind, daneben Asylsuchende aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und anderen Ländern.
Bei dem Menschen, von dem im heutigen Predigttext die Rede ist, war es noch anders: Er wanderte aus, mit all seiner Habe, in ein fremdes Land, wo ihn auch nicht immer Alle mit offenen Armen aufnahmen, aber er ging nicht aus materieller Not oder aus Angst um sein Leben. Er ging, weil er den Auftrag dazu erhalten hatte. Im ersten Buch Mose lesen wir, dass es Gott war, der dem Stammvater Abram folgenden Befehl gab:
„Verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und dein Elternhaus! Zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich werde dich segnen und deinen Namen überall berühmt machen, sodass er zu einem Inbegriff des Segens wird. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen, und wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden.“
Da machte sich Abram auf den Weg, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Sein Neffe Lot ging mit ihm. Abram war 75 Jahre alt, als er seine Heimat verließ.
Asyl, Migration, Einwanderungsgesetze, diese Schlagworte bestimmen im Augenblick große Teile der Debatte in unserem Land. Viele Menschen lehnen diejenigen ab, die zu uns kommen, auch wenn deren Gründe nachvollziehbar sind. Auf der anderen Seite brauchen dringend Menschen die zu uns kommen, denn Fachkräftemangel ist überall zu spüren: Wer wird uns demnächst in den Krankenhäusern und Altenheime pflegen? wer ersetzt dieÄrzte, die nun in großer Zahl in den Ruhestand gehen? Und wer will unseren Müll entsorgen und den Spargel stechen? In dieser Woche wurde die Prognose bekannt, dass wir vermutlich pro Jahr 1,5 Million Fachkräfte brauchen… Das erinnert an die 60er Jahre: Der millionste italienische „Gastarbeiter“ bekam ein Motorrad geschenkt.
Wir sollten uns für Verhältnisse einzusetzen, dass niemand um sein Leben und seine Unversehrtheit in seinem Land fürchten muss. Aber wenn jemand kommt, der wirklich in Not ist, dürfen wir uns nicht verschließen. „Die Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken“ sagt Gott einmal. Und zugleich macht er Abram zu einem Fremden. Er gibt ihm die Aufgabe, ein Segen für andere zu sein. Menschen, denen Abrahams begegnet, werden gesegnete sein.
Es gibt auch heute Menschen, von denen gesagt wird: Jeder, der ihnen begegnet, geht irgendwie getröstet, heiter oder ermutigt weiter. Nicht viele gibt es davon allerdings, leider….
Wir können sicher nicht aus unserer Haut heraus und ab morgen alle solche Menschen sein. Aber solche können wir werden, die sich sagen: Ich will es immer wieder mal probieren, so ein „ganz kleiner Segen“ für Andere zu sein. Ab morgen will ich es probieren, den Menschen, die mir begegnen anders gegenüberzutreten, als bisher. Ich will lernen, das Positive zu sehen, mich nicht selbst in den Vordergrund zu drängen, zuzuhören, statt immer nur zu reden, keine Sensationen zu verbreiten, sondern ein bisschen Freude….
Ist es eigentlich ein Zufall, dass Abraham, der ein Segen sein sollte, Stammvater dreier Religionen ist?
Im Judentum gilt er als Stammvater des jüdischen Volkes, Vorbild des Gesetzes-Gehorsams, als idealer Jude, gerechtfertigt durch seine Werke der Glaubenstreue beweisen. Er gilt als Vorbild für das Bestehen schwerster Glaubensprüfungen und ist Empfänger der Verheißungen Israels: Volk und Land.
Für das Christentum hat sich das, was Abraham verheißen wurde, in Christus erfüllt. Abraham ist somit Stammvater von Juden und Christen, der geistige Vater aller Glaubenden. Er ist Vorbild unerschütterlicher Glaubenstreue, gerechtfertigt durch seinen Glauben. Das Isaak-Opfer gilt als Prototyp für die Hingabe des Gottes-Sohnes durch Gott-Vater. Abraham ist Empfänger der Verheißungen für alle Völker.
Im Islam ist Abraham der Stammvater der Araber. Er ist Vorbild bedingungsloser Unterwerfung. Durch Gottesglauben, Gottesdienst und gottgefälliges Leben habe Abraham Gerechtigkeit erlangt. Sein Aufbruch aus Ur sei der Prototyp für die Auswanderung des Propheten Mohammed aus Mekka, und die ursprünglichen Offenbarungen, die Abraham erhielt, seien im Koran niedergelegt.
Natürlich gibt es da Unterschiede, aber Abraham ist jedenfalls eine Person, die als gemeinsames Erbe dreier Religionen zum gegenseitigen Verständnis beitragen könnte.
Abrahams war 75, als der Ruf Gottes an ihn erging. Nicht ein junger, dynamischer Mann, ein Macher, ein Managertyp macht sich auf die Reise, sondern einer, der sich schon längst auf sein Altenteil hätte zurückziehen können.
Aber Gott geht eben nicht nach Jahren. Schon im Alltagsleben gilt: Man ist so alt, wie man sich fühlt. Das scheint erst recht für den Glauben zu gelten…
Manchmal muss man eben etwas wagen, egal, wie alt man ist. So wie es in der folgenden Geschichte:

Es war an einem schönen Sommerwochenende. Ein Bärenraupe kriecht langsam am Rand eines Weges entlang. Sie hat mächtigen Hunger! Nun macht sie eine kleine Kehrtwendung und steuert stracks auf eine Straße zu, eine Bundesstraße. Gerade setzt sie einen ihrer kurzen Stummelfüße auf den Rand der breiten asphaltierten Fahrbahn, da kommt ein Mensch auf sie zu. Sie erschrickt ein wenig und zieht sich zusammen. Der Mensch erscheint ihr riesig. Ein Tritt von ihm genügte, und es wäre zu Ende mit ihr; doch er beugt sich zu ihr herunter und spricht sie an:
Sag mal, sagt er zu ihr, du bist wohl verrückt! Du kannst hier doch nicht rübergehen! Ein Meter höchstens, dann hat’s dich erwischt. Siehst du die vielen Autos nicht? Zwanzig Stück in der Minute – PKWs, Laster, Busse.
Nein, die Bärenraupe weiß nichts von PKWs, Lastern und Bussen.
Pass mal auf, sagt der Mensch wieder zu ihr, du musst dich halt damit abfinden. Du bist eben auf dieser Seite der Straße geboren worden – das ist Pech, aber das musst du schlucken.
Du bist zu klein, sagt der Mensch, und vor allem: zu langsam.
Die Bärenraupe aber sieht vor allem die andere Seite der Straße. Dort strotzt es nur so von saftigem Grün! Sie hat Lust auf Grün – und mächtigen Hunger. Man müsste hinüber! Zwanzig Autos in einer Minute. Bei einer halben Stunde Wegzeit gleich 600 Autos. 600 gegen einen – es lohnt sich nicht, oder?
Du schaffst es nicht, sagt der Mensch. Sechs Meter Asphaltstraße, das ist nichts für eine Bärenraupe. Was bist du denn schon? Was bist du erst gegen so viele Autos? So gut wie nichts. Weniger noch. Eines der kleinsten Tiere, kein Panzer, keine schnellen Füße, kein scharfes Gebiss.
Das Grün. Die Bärenraupe sieht nur das Grün, sieht nicht die PKWs, die Laster, die Busse. Keine Chance für eine Bärenraupe. Keine Chance. Sechs Meter Asphalt. Egal. Sie geht los. Geht los auf Stummelfüßen. Zwanzig Autos in der Minute. Geht los ohne Hast. Ohne Furcht, ohne Taktik. Sie geht los und geht und geht und kommt an.
Wir haben mehr Chancen als die Bärenraupe: Also, gehen wir los. Im Namen Gottes und mit Gott an unserer Seite.
Amen.
4. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Johannes 7, 37f
Liebe Leserinnen und Leser,
wir alle kennen Wortpaare wie „Tag und Nacht“, „arm und reich“, „dick und dünn“. Diese Begriffspaare bestehen aus Worten, die zusammen erst ein Ganzes ergeben: Tag und Nacht machen den gesamten Tagesablauf aus, arm und reich die ganze Gesellschaft.
Aber nicht immer gibt es solche Gegenstücke. Wenn wir hungrig sind und genehmigen uns ein reichhaltiges Essen, sind wir satt. Aber wenn wir durstig gewesen sind und haben dann genug getrunken, dann sind wir… sprachlos! Das Gegenstück zu „durstig“ fehlt nämlich in unserer Sprache und einfach „undurstig“ zu sagen, hört sich irgendwie komisch an.
Vor knapp 25 Jahren wollte man das ändern. Ein großer Eis-Tee-Hersteller forderte zusammen mit der Duden-Redaktion Menschen auf, ein Ersatzwort dafür zu finden: ein Adjektiv also, das den Zustand beschreibt, keinen Durst mehr zu haben. An dem ausgeschriebenen Wettbewerb nahmen mehr als 100.000 Personen teil und eine Fachjury wählte das passendste Wort aus. Auf der Strecke blieben zusammengezogene Wörter wie „nimedu“ für „nicht mehr durstig“ oder „dulo“ für „durstlos“ ebenso wie „gewässert“, „gelöscht“ oder „abgefüllt“.
Das Wort, auf das man sich schließlich einigte, bilde mit seinem Gegenstück sogar einen Stabreim, erläuterte damals der Leiter der Duden-Redaktion. Dazu aber am Ende mehr…
Um Durst bzw. um das Durstig-Sein geht es auch im heutigen Predigttext. Es ist ein Wort aus dem Johannes-Evangelium, in dem es genau um dieses Thema, das Durstig-sein, geht. Jesus sagte demnach einmal zu seinen Zuhörerinnen und Zuhörern:
Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken! Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen.

Wir alle kennen die alte Werbung einer amerikanischen Getränkefirma: „Mach mal Pause – trink Coca-Cola.“ Diese Werbung oder die noch viel raffiniertere unserer Tage ist dafür da, dass Menschen erst einmal Durst bekommen, den sie dann natürlich mit einer eiskalten Cola löschen sollen.
Verhält sich die Kirche nicht ähnlich? Manche Menschen meinen tatsächlich, dass die Kirche die Menschen erst zu fragenden, suchenden und lebenshungrigen Menschen machen möchte, um dann helfend einspringen zu können, etwa so:
– Ihr habt doch sicher irgendwelche Fragen: Wir bieten Antworten.
– Sucht ihr nach Gott? Wir zeigen euch den Weg.
– Seid ihr durstig nach Leben? Wir können diesen Durst stillen…
Hat die Kirche es wirklich nötig, einen künstlich hervorgerufenen „Hunger nach Leben“ zu erfinden, oder kann unser heutiger Lebensstil viele Menschen wirklich nicht mehr innerlich satt machen?
Könnten die virtuellen Welten den Hunger nach Leben wirklich stillen?
Oder die Gewalt?
Oder Drogen?
Oder ungezügelter Konsum und unbeschränkter Reichtum?
Wir müssen nicht die Institution Kirche retten, aber wir haben aus Fürsorge für den Menschen auf den hinzuweisen, der von sich sagt, dass er den Hunger und den Durst nach Leben stillen kann, auf Christus, der von sich sagt:
Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken!
„Trinken“ ist für viel Menschen anscheinend tatsächlich die „Lösung“ ihrer Probleme, nämlich das Trinken von alkoholische Getränken, der Griff nach der Flasche… Früher hat man gesungen:
Trink, trink Brüderlein trink,
Lass doch die Sorgen zu Haus…
Aber da blieben sie nicht, die Sorgen, bzw. man traf sie spätestens, wenn man nüchtern war, wieder.
Die Folgekosten der Alkoholkrankheit für die Gesellschaft sind enorm. Der Alkoholatlas 2017 beziffert die direkten und indirekten Kosten des Alkoholkonsums 2016 in Deutschland auf fast 40 Milliarden Euro. Unter Alkoholeinfluss werden außerdem zahlreiche Straftaten wie Diebstahl, Raub oder Betrug begangen, dazu kommen indirekte Kosten, z. B. durch Arbeitsunfähigkeit oder durch Unfälle unter Alkoholeinfluss.
Besonders leiden Kinder und Jugendliche in alkoholbelasteten Familien. Sie haben in der Schule und beim Berufseinstieg vielfach schlechte Chancen usw.
Jesus redet aber natürlich nicht vom Alkohol, obwohl auch er auch gerne einmal ein Glas Wein getrunken hat. Er redet von dem natürlichen Wasser, das für Tiere, Menschen und Pflanzen kostbar und lebensnotwendig ist. Jesus sagt, das Wasser, das Gott uns schenken will, sei für Christinnen und Christen ebenso kostbar und lebensnotwendig.
Was aber ist mit dem lebendigen Wasser gemeint, von dem Jesus spricht?
Es ist Liebe unseres Gottes, seine Freundlichkeit und Barmherzigkeit, seine Güte und Nachsichtigkeit.
Dieses Wasser brauchen wir als Christen für unser geistliches Leben wie wir Wasser für unseren Körper brauchen. Stellen wir uns einmal vor, wir würde nur einmal in der Woche oder einmal im Jahr Wasser trinken, wir würden nicht lange überleben.
Und wie ist es mit dem Wasser des Lebens, das Gott schenken will? Wie ist es mit seiner Freundschaft, seiner Nähe, seiner Vergebung: Trinken wir regelmäßig davon?
Ernährungswissenschaftler sagen uns, dass die meisten Menschen zu wenig trinken. Drei Liter am Tag wären gut. Was würde das wohl bedeuten im Bezug auf das Wasser des Lebens?
Nun bleibt Jesus allerdings nicht dabei stehen, uns zum Konsum des lebendigen Wassers, des Wassers des Lebens, einzuladen. Vielmehr sollen wir selber zu einer Quelle solchen Wassers für andere Menschen werden.
Voraussetzungen gibt es nicht viele, eigentlich nur eine, dass wir uns selbst nämlich unseren Lebensbecher mit lebendigem Wasser vollgießen lassen.
Was daraus wohl wird? Ich bin überzeugt, dass es Auswirkungen auf Andere haben wird, wenn wir den Wert des lebendigen Wassers für uns erkennen: innerer Friede oder Glaubensgewissheit oder auch nur die Gewissheit, dass Gott mich hört, wenn ich mich mit meine Fragen, Zweifeln oder Freuden an ihn wende. Hoffentlich geht von vielen Menschen, die in dieser Weise Gottes lebendiges Wasser kennengelernt haben, auch lebendiges Wasser aus, d.h. dass sie von Gottes Liebe, seiner Freundlichkeit und Güte weitererzählen.
Zum Schluss bin ich Ihnen noch die Antwort schuldig auf die Frage, was sich die Duden-Redaktion ausgedacht hat für den Zustand, keinen Durst mehr zu haben. „Sitt“ soll das neue Wort heißen. „Jetzt bin ich sitt und satt“, könnte künftig am Ende einer gepflegten Mahlzeit stehen. Ob sich das Wort durchsetzen wird, können die Sprachforscher nicht prophezeien: „Wenn die Sprachgemeinschaft es verwendet und sich genügend schriftliche Belege zusammentragen lassen, kann das neue Wort auch in den Duden kommen“, heißt es.
Ob sich das Wort „sitt“ durchsetzen wird, weiß ich nicht, aber ich wünsche mir, das wir alle (nicht nur am Sonntag) geistlich gesehen „sitt und satt“ sein mögen!
Amen.
2. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Lukas 14, 16-24
Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt Menschen, die sich am liebsten alles bis zum Schluss „offen halten“: Sie sagen bei einer Einladung, dass sie wahrscheinlich kommen, auf Nachfrage eine Woche später, dass sie es auf jeden fall versuchen werden, an ende rufen sie an, dass sie es voraussichtlich doch nicht schaffen, zu kommen. Für Gastgeberinnen oder Gastgeber ist das kein schönes Gefühl, sie sind gekränkt, ihre Einladung scheint nicht wirklich wichtig genommen worden zu sein.
Jesus erzählt einmal von einem Mann, dem es ähnlich erging: Er hatte zu einem großen Fest eingeladen, aber es kam Absage auf Absage.
Ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen: „Kommt, alles ist bereit!“ Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte: „Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.“ Ein anderer sagte: „Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich“ Und ein dritter sagte: „Ich habe gerade erst geheiratet; darum kann ich nicht kommen.“ Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm alles. Der wurde sehr ärgerlich und sagte: „Geh schnell auf die Straßen und Gassen und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein!“ Bald darauf meldete der Diener: „Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch immer Platz vorhanden.‹“ Da sagte der Herr: „Geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird! Aber von denen, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen.“
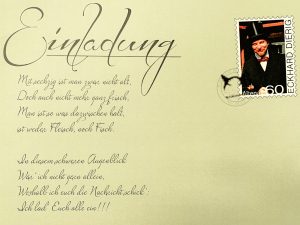
Ein Mann lädt Gäste ein- und alle lassen sich entschuldigen. Das ist ärgerlich, aber bei genauerer Betrachtung sind die Gründe für die Absagen durchaus nachvollziehbar. Eigentlich kann der verhinderte Gastgeber niemandem wirklich böse sein:
– 10 Ochsen hat einer gekauft, auf heute übertragen: einen neuen Traktor oder ein nobles Auto, das ausgerechnet an diesem Abend geliefert wird…
– Einen Acker hat ein anderer gekauft, auf heute übertragen: ein neues Haus, und an diesem Abend ist die Schlüsselübergabe…
– Der dritte hat geheiratet, die Übertragung erübrigt sich, Hochzeitsnacht, rauschendes Fest, Gäste…
Und dennoch: Wenn man etwas wirklich will, kann man vieles: Die Ochsen und den Acker kann ich allemal auch später ansehen, davon geht die Welt nicht unter. Eine Heirat ist zugegebenermaßen nicht so leicht zu verschieben. Aber wenn man von seinem Arzt gesagt bekäme, dass man schwer erkrankt sei und nur durch eine sofortige Operation gerettet werden könnte, würde man selbst eine Hochzeit verschieben. Man muss schließlich Prioritäten setzen.
Und wie sieht es mit der Einladung Gottes aus? Viele Menschen sehen die Einladung Gottes als eine lästige Pflicht an, andere halten sie für unwichtig. Daneben gibt es natürlich auch diejenigen, die die Einladung grundsätzlich ablehnen, aber die sind im Gleichnis gar nicht im Blick.
Gott lädt ein zu einer lebendigen Beziehung mit ihm selber, zum Gebet, zum Lesen seines Wortes, zum Gottesdienst. Seine Einladung dient nicht dazu, unser Leben durcheinander zu bringen, sondern innezuhalten in unserer Hektik und die uns geschenkte Zeit sinnvoll zu nutzen.
Der Hausherr im Gleichnis Jesu ist tief enttäuscht. Das ist menschlich gesehen vielleicht übertrieben, aber es geht ja im tieferen Sinn nicht um die Einladung zu irgendeiner Party, sondern um die Einladung zu einem Leben mit Gott, um die Teilhabe an seinem Reich. Man kann über die Einladung Gottes ganz unverbindlich diskutieren, oder aber man kann sie ganz konkret auf sich selber beziehen. Jesus wollte seine Zuhörer immer direkt ansprechen, und wenn das Gleichnis Bedeutung für uns gewinnen soll, dann sollten wir uns heute davon ansprechen lassen, uns hier und heute einladen lassen.
Die Einladung Gottes wird besonders deutlich im Abendmahl ausgesprochen: Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist! Aber auch die Predigt, das Wort eines Mitchristen oder ein Artikel in einer christlichen Zeitschrift können Einladungen Gottes sein. Es sind Einladungen wie von guten Freunden, nicht wie Vorladungen bei Gericht.
Stimmt es eigentlich, wenn wir in bestimmten Situationen sagen, wir hätten keine Zeit? Machen wir uns und Anderen mit solchen Aussagen nicht etwas vor? Zeit kann zu Ende gehen- wenn unser Zeit gekommen ist. Der Tod sagt uns dann: Du hast keine Zeit mehr- für ein gutes Gespräch, eine schönes Erlebnis, einen liebevolle Begegnung. Solange wir leben aber haben wir Zeit, weil Zeit ein Geschenk Gottes ist. Die Frage ist lediglich: Was tun wir mit und in dieser Zeit? „Ich habe keine Zeit.“, bedeutet nichts andere als: „Ich habe meine Zeit für etwas anderes eingeplant.“
Vor einigen Jahren hatte ich die neuzugezogenen Gemeindeglieder eines Jahres zu einem Begrüßungs-Gottesdienst eingeladen, leider mit geringem Erfolg. Ein Bekannter aus der Werbebranche sagte mir: „Dein Anschreiben war viel zu lang, und dann die ganzen Anlagen, das liest heute kein Mensch mehr. du weißt doch: In der Kürze liegt die Würze… Konzentrier dich auf das Wesentliche!“
Was aber ist das Wesentliche? Was ist der Mittelpunkt unseres Glaubens? Was würden Sie antworten, wenn Sie gebeten würden, in einer Minute zu sagen, warum jemand in den Gottesdienst, den Kirchenchor oder den Seniorenclub gehen sollte, warum man Mitglieder einer Kirche sein sollte, warum man der Einladung Gottes folgen sollte?
Wenn wir als Gemeinde im Namen Gottesdienst Menschen zu Gott einladen wollen, müssen wir alle an einem Strang ziehen, die Form der Einladung muss stimmen, das Gebäude genauso ansprechend sein wie die Lieder und das „Drumherum“. Vor allem aber muss der Inhalt stimmen, den dürfen wir nicht beliebig verändern. Der Diener im Gleichnis hätte auch nicht einfach zu einer Zirkusveranstaltung einladen dürfen, selbst wenn dann mehr Menschen gekommen wären.
Im Übrigen gilt: Wenn die äußeren Bedingungen ansprechend sind und die Botschaft klar ist, sind wir im Letzten nicht mehr für das Scheitern unserer Einladung verantwortlich.
Warum ist es eigentlich so wichtig, den Menschen von der Einladung Gottes zu berichten? Nicht zuletzt deswegen, weil das Gleichnis zwar für die vielen, die kommen wollen, gut ausgeht, die zunächst eingeladenen aber nicht mehr eingelassen werden. Darum ist es unserer Aufgabe, phantasievoll und fröhlich, aber auch besonnen und ernst einzuladen zu Gott, damit keiner bei seinem großen Abendmahl am Ende der Zeit draußen bleiben muss.
Amen.
1. Sonntag nach Trinitatis 2023
Text: Genesis 28, 10 – 22 i. A.
Liebe Leserinnen und Leser,
das Erste Buch Mose, genannt Genesis, nimmt uns heute mit in eine Traumvision, die auf einer brutalen Familientragödie beruht…
Wir begegnen Jakob, dem Urvater des Glaubens, als er noch jung und stürmisch und auf der Suche nach dem rechten Kurs im Leben ist. Jakob hat einen Zwillingsbruder namens Esau. Schon im Mutterleib sollen die beiden darum gekämpft haben, wer als Erster das Lichte der Welt erblicken würde. Die Eltern schüren die Konkurrenz der beiden Brüder später sogar noch, indem jedes Elternteil einen der Söhne zum Lieblingssohn macht: Jakob ist der Liebling seiner Mutter, Esau der Liebling seines Vaters.
Als Isaak, der Vater der beiden rivalisierenden Brüder, alt geworden ist, will er nach altem Brauch seinen Erstgeborenen, der ja auch sein Lieblingssohn ist, segnen. Damit würde er ihn zu seinem Nachfolger, zum Erben und Chef des ganzen Clans machen, einschließlich seines Bruders. Isaacs Frau, Rebekka, bekommt das mit und beschließt, dass sie jetzt handeln müsse. Sie verkleidet ihren Lieblingssohn Jakob mit viel Geschick und Fantasie als seinen älteren Bruder Esau. So soll der alte und inzwischen erblindete Isaak getäuscht werden. Der wird zwar zunächst misstrauisch, aber auf Nachfrage lügt Jakob und behauptet, tatsächlich Esau zu sein. Daraufhin segnet der Alte fälschlicher Weise seinen jüngeren Sohn Jakob. Als Esau einige Zeit später heimkommt, ist der Segen vergeben, Jakob ist zum Herrn über alles bestimmt. Isaak kann diese Zusage nicht zurücknehmen, auch wenn er über das Geschehen sehr unglücklich ist. Esau aber ist total wütend und droht, seinen betrügerischen Bruder zu ermorden, sobald der Vater verstorben sei. Jakob kann im Moment nichts anderes tun, als zu fliehen.
Hier auf der Flucht begegnen wir Jakob. Was nutzt ihm nun sein Segen, allein, ohne Familie und Freunde, ohne eine Perspektive, dafür aber mit einer Morddrohung im Nacken?!
Jakob machte sich auf den Weg. Als es Nacht wurde, nahm er einen Stein und legte ihn unter seinen Kopf, um zu schlafen. Er träumte, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Oben an der Treppe stand Gott, der Herr, und sprach:
„Ich bin der Gott deines Vaters Abraham, und Isaaks Gott; das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Ich bin mit dir und will dich behüten und will dich wieder zurückbringen in dieses Land.“
Als Jakob vom Schlaf aufwachte, sprach er:
„Fürwahr, der HERR ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht!“
Und er fürchtete sich und sprach:
„Hier ist Gottes Haus, die Pforte des Himmels.“
Und er stand auf und nahm den Stein, auf dem er geschlafen hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal. Und er legte ein Gelübde ab und sprach:
„Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Weg, den ich reise, und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der HERR mein Gott sein. Und dieser Stein soll ein Gotteshaus werden.“
Wann haben Sie sich das letzte Mal erschreckt?
Vielleicht als eine besondere große und besonders stark behaarte Spinne über den Tisch kroch oder als eine Tür vom Sturm heftig zugeschlagen wurde? Solches Erschrecken ist natürlich alles andere als schön, aber es ist auch nicht wirklich gefährlich oder besorgniserregend. Wirkliches Erschrecken sieht anders aus, wenn z. B. ein Auto auf eisglatter Straße plötzlich ins Schleudern kommt, wenn eine scheinbar gute Ehe plötzlich zerbricht oder ein geliebter Mensch unerwartet stirbt.
Ein solches Erschrecken kann wehtun, sehr weh sogar. Aber es gibt auch ein Erschrecken, das heilsam sein kann, etwa das Erschrecken über einen so genannten „Blauen Brief“, der früher ins Haus flatterte, wenn die Versetzung gefährdet war, was oftmals dazu führte, sich anzustrengen und das Klassenziel sicher zu erreichen. Oder das Erschrecken über einen Herzinfarkt, woraufhin der Patient seine gesamte Lebensführung gesunder, ruhiger und bewusster gestaltet und noch viele Jahre genießen kann.
Jakob erschrickt auch, und zwar sehr heftig: Ganz unmittelbar, ganz plötzlich ist er mit Gott konfrontiert, den er bisher nur aus den Erzählungen seines Vaters kante. Jetzt kommt ihm dieser Gott ganz nahe, der Herr der Welt, der Herr über Leben und Tod.
Was ist das für ein Erschrecken, wenn wir plötzlich Gott begegnen?
Eines das Furcht, Angst und Entsetzen auslöst? Ganz im Gegenteil:
 Die Hirten auf dem Feld erschrecken zwar zunächst, als ihnen die Engel begegnen, aber die haben nur die eine Botschaft für sie: Fürchtet Euch nicht, wir verkünden Euch nämlich eine freudige Botschaft!
Die Hirten auf dem Feld erschrecken zwar zunächst, als ihnen die Engel begegnen, aber die haben nur die eine Botschaft für sie: Fürchtet Euch nicht, wir verkünden Euch nämlich eine freudige Botschaft!
Drei Frauen erschrecken am Ostersonntag auch beim Anblick des göttlichen Boten im Grab Jesu, aber auch dieser Bote hat nur eine gute Botschaft: Fürchtet euch nicht, Jesus ist auferstanden!
Die Begegnung mit Gott ist im Letzten immer als ein heilsames Erschrecken, weil Gott immer unser Heil im Blick hat.
Bei Jakob ist es nicht anders. Das Erlebnis der unmittelbaren Nähe Gottes hat ihn tief berührt. Er baut einen Altar und verspricht, Gott zu dienen, wenn der ihn wieder nach Hause bringen wird.
Noch aber ist Jakob auf der Flucht, und das wird noch eine Zeitlang so bleiben. Gottes Ziel ist jedoch nicht die Flucht Jakobs, sondern seine Rückkehr in das Land seiner Väter und die Versöhnung der zerrissenen Familie.
Dieser Weg, diese Umkehr, wird einem Menschen zugesagt und zugetraut, der ein Betrüger und Lügner ist, der den Namen Gottes missbraucht hat, einem listigen und verschlagenen Mann. Gott bietet ihm einen Neuanfang, bietet ihm Begleitung auf seinem Weg. Dabei stellt er keine Vorbedingungen. Viele Menschen, die sich auf Gott einlassen, haben einen ganz normalen Lebenslauf. Die vorbehaltlose und voraussetzungslose Gnade Gottes wird aber dort besonders deutlich, wo ein Knacki zum Prediger wird, ein Zuhälter zum Offizier der Heilsarmee, ein Betrüger und Lügner zum Vater des Glaubens.
Wichtig ist, dass Jakob die Leiter nicht selbst an den Himmel stellen muss. So stellen wir uns den Glauben ja nicht selten vor: Wir müssen durch unsere Werke und unser Tun die Leiter zu Gott erklimmen. Hier aber stellt Gott uns eine Leiter zur Verfügung, auf der seine Engel zu uns herabsteigen.
Der Weg, der vor uns als Kirche liegt, ist ein ebenso schwieriger und steiniger Weg wie der von Jakob. Sowohl die Mitgliederzahlen als auch die finanziellen Mittel werden schrumpfen.
Wie geht es weiter? Wird alles immer nur schlechter?
Denken wir lieber positiv, denken wir daran, wie die Geschichte von Jakob zu Ende geht:
Jakob findet in der Fremde eine wunderschöne Frau, gründet eine Familie, kommt durch seine Arbeit und seinen Fleiß zu großem Reichtum. Aber er hat immer den Drang, umzukehren, zurückzukommen nach Hause. Und immer wieder erlebt er, dass Gott ihn auf all seinen Wegen begleitet. Am Ende hält Jakob es nicht mehr aus. Er will zurück zu seiner Mutter, seinem Bruder. Auf die Gefahr hin, dass ihn sein Bruder mit seinen Soldaten vernichtet, wagt er mit Gottes Hilfe den Schritt zur Versöhnung, die am Ende gelingt.
Jakob ist seinen Weg gegangen unter dem Segen Gottes. Segen bedeutet, einem Menschen zuzusprechen, dass Gott ihn auf seinem Weg begleitet. Das hat Jakob erfahren dürfen. Einen solchen Segen dürfe auch wir uns zusprechen lassen, wir als Einzelne, als Gemeinde und als Kirche.
Amen.
Trinitatis 2023
Text: 4. Mose 11 i. A.
Liebe Leserinnen und Leser,
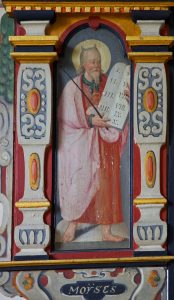
die Frage, wieviel Fleisch der Mensch produzieren und verzehren soll, bewegt die Menschheit nicht erst seit gestern. Es sind Fragen der Gesundheit, des Tierwohls und seit einiger Zeit auch des Klimaschutzes, die zu dieser Fragestellung führen. Menschen, die sich um diese Fragen ernsthafte Gedanken machen, schwanken zwischen verringertem Fleischverzehr, vegetarischer und veganer Lebensweise.
Es überrascht vermutlich manchen Zeitgenossen, wenn er erfährt, dass die Frage des Fleischkonsums die Menschen auch schon vor fast 3000 Jahren umtrieb und dass davon schon in der Bibel berichtet wird.
In unserem heutigen Predigttext geht es genau darum, um den Konsum von Fleisch. Der Text führt in die Zeit nach dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Das Volk ist in der Wüste, und als die Menschen hungrig werden, speist Gott sie mit Manna, das nachts mit dem Tau aufs Lager fällt: Die Leute sammeln es und backen Fladen daraus. Dann aber heißt es im 4. Mose 11:
Unter den Fremden, die sich dem Volk Israel angeschlossen hatten, brach eines Tages ein unwiderstehliches Bedürfnis nach Fleisch aus. Die Israeliten ließen sich davon anstecken und fingen nun auch an zu jammern:
„Wenn uns doch nur jemand Fleisch verschaffen würde! Wie schön war es doch in Ägypten! Da konnten wir Fische essen und hatten Gurken und Melonen. Aber hier gibt es tagaus, tagein Manna. Das bleibt einem ja im Hals stecken!“
Mose hörte die Leute klagen und sagte zum HERRN:
„Womit habe ich es verdient, dass du mir eine so undankbare Aufgabe übertragen hast? Dieses Volk liegt auf mir wie eine drückende Last… Ich allein kann dieses Volk nicht tragen, die Last ist mir zu schwer.“
Der HERR antwortete Mose:
„Versammle siebzig angesehene Männer, die sich bewährt haben, und hole sie zum Heiligen Zelt. Dort sollen sie sich neben dir aufstellen. Ich werde von dem Geist, den ich dir gegeben habe, einen Teil nehmen und ihnen geben. Dann können sie die Verantwortung für das Volk mit dir teilen und du brauchst die Last nicht allein zu tragen. Zum Volk aber sollst du sagen: ‚Ihr sollt einen Monat lang Fleisch bekommen! ’“
Mose erwiderte:
„Das Volk hat allein 600.000 wehrfähige Männer, wie willst du denen einen Monat lang Fleisch zu essen geben?!“
Und der HERR antwortete:
„Meinst du etwa, es gibt eine Grenze für meine Macht? Du wirst sehen, ob meine Zusage eintrifft oder nicht.“
Schlechte Nachrichten verbreiten sich heute sehr schnell:
– Da macht eine Zeitung Andeutungen, dass es einem Unternehmen schlecht geht, und schon sinken die Kurse, der Konzern gerät in eine Schief-Lage.
– Da redet jemand in der Tagesschau über eine Krankheit, die es schon seit Jahrzehnten gibt, und plötzlich bricht eine allgemeine Hysterie aus.
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren…
Schlechte Nachrichten haben es immer schon leicht gehabt, ansteckend zu werden. Die Viren der Unzufriedenheit können eine Spirale der Frustration entstehen lassen, die sich immer schneller bewegt und nur schwer zu stoppen ist.
Die Fremden, die sich dem Volk Israel angeschlossen hatten, hatten plötzlich das Bedürfnis nach Fleisch. Das ist zunächst verständlich, mussten sie doch schon viele Tage lang Manna essen, das den Israeliten auf ihrer 40-jährigen Wanderschaft durch die Wüste oft als Nahrung gedient hatte. Beschrieben wird Manna als „weiß wie Koriandersamen und mit dem Geschmack von Honigkuchen.“
Mögen Sie Honigkuchen? Selbst wenn das der Fall ist, stellen Sie sich vor, ihn morgens und abends essen zu müssen, tagein, tagaus. In kleinen Mengen ganz lecker, aber immer möchte man ihn wohl kaum essen.
Die Israeliten waren Manna gewohnt, aber nun lassen sie sich anstecken von der Nörgelei der Fremden und vergessen die Dankbarkeit über die Rettung vor dem Hungertod: Jetzt plötzlich wollen sie auch Fleisch!
Lassen wir uns in Bezug auf den Glauben und unsere Kirche nicht auch allzu leicht von negativen Schlagzeilen anstecken, als würde immer alles schlimmer und schlechter? Setzen wir dagegen doch einmal eine positive Lawine in Gang: Reden wir über das, was gut bei uns ist, damit wir die Möglichkeit haben, es noch besser zu machen.
Um Gutes besser zu machen, gibt es in evangelischen Kirchen alle vier Jahre eine Presbyteriumswahl. Erste Vor-Entscheidungen mussten schon getroffen werden. Wichtiger aber als formale Entscheidungen ist die Frage, wer sich als Presbyterin oder Presbyter zur Verfügung stellt. Im Presbyterium sind Männer und Frauen gefragt, die in besonderer Weise Verantwortung tragen, indem sie die Gemeinde zusammen mit den Pfarrerinnen und Pfarrern leiten.
Nicht anders ist es offenbar bei Mose, der die Last des Volkes plötzlich als zu groß für sich alleine empfindet. Gott gibt ihm den Rat, die Verantwortung und die Last zu teilen. 70 Älteste, die sich bewährt haben, werden ausgewählt. Gott nimmt etwas von dem Geist, den er Mose gegeben hatte, und gibt den 70 Ausgewählten einen Teil davon. Die Bibel berichtet nicht, dass Mose danach weniger von diesem Geist gehabt hätte. So wie geteilte Freude doppelte Freude ist, scheint sich auch der Geist Gottes durch Teilen zu vermehren. Wo Menschen sich miteinander von diesem Geist bestimmen lassen, da entsteht etwas, das Pfingsten zur Entstehung der Kirche geführt hat und das es der Kirche von heute möglich macht, ihrer Verantwortung in der Welt gerecht zu werden.
Mose wird in unserem Text als ein Zweifelnder dargestellt: Wie will Gott wohl seine Zusage wahr machen? Ich finde es bemerkenswert, dass auch ein Mensch, der so fantastische Dinge mit Gott erlebt hat wie Mose, Momente des Zweifelns kennt. Es zeigt, dass er ein Mensch war wie wir: Auch heute erleben Menschen Dinge mit Gott, die sie froh und gewiss machen, und dann gibt es wieder Tage, an denen die Zweifel kommen.
Mose zweifelt eine Zeitlang daran, dass Gott so viele Menschen mit Fleisch versorgen kann, er zweifelt an Gottes Allmacht. Aber das ist das Besondere an Gott: Auch und gerade diesen Menschen braucht er für etwas ganz Großes. Mose wird zum Beispiel dafür, dass Gott jeden Menschen in seinen Dienst stellen kann, weil es eben nicht in erster Linie darum geht, wie perfekt jemand ist, sondern wie sehr er sich auf den Geist Gottes einlässt.
Die Herausforderungen der Zukunft sind für di Kirchen groß und bedürfen verstärkter Anstrengungen. Aber als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Herrn, dem nichts unmöglich ist, und der uns seinen Heiligen Geist schenkt, müssen wir nicht resignieren.
Damals sandte Gott den Israeliten übrigens große Mengen von Wachteln, um ihren Hunger nach Fleisch zu stillen, die Zweifel von Mose waren unbegründet: Ein gutes Vorbild für uns hier und heute!
Amen.
Pfingsten 2023
Text: Apostelgeschichte 2 i. A.

Liebe Leserinnen und Leser,
was Weihnachten und Ostern bedeuten, ist den meisten Menschen in unserem Land auch heute noch einigermaßen bekannt. Aber wenn nach Pfingsten gefragt wird, zuckt mancher Zeitgenosse mit den Schultern, obwohl Pfingsten zu den drei großen Festen der Christenheit gehört!
Ganz vereinfacht könnte man die Frage nach dem Pfingstfest so beantworten: Am Pfingstfest feiert die Kirche ihren „Geburtstag“. Die „Geburt“ bzw. die Entstehung der Kirche wird uns in der Apostelgeschichte des Lukas mit folgenden Worten geschildert:
Als das Pfingstfest gekommen war, waren alle Jünger am selben Ort versammelt. Plötzlich gab es ein gewaltiges Rauschen. Gleichzeitig sahen sie etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden; jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab.
Erstaunt fragten sich die Menschen, die das hörten, was das zu bedeuten habe.
Da trat Petrus vor die Menge und erklärte:
„Hört zu: Hier geschieht genau das, was Gott durch seine Propheten angekündigt hat, als er sagte: ‚Am Ende der Zeit werde ich meine Geist ausgießen über alle Menschen, die mir dienen, und sie werden prophetisch reden.‘ Bei dem, was ich euch zu sagen habe, so fuhr Petrus fort, geht es um Jesus von Nazareth. Er wurde von Gott aus der Gewalt des Todes befreit und zum Leben erweckt. Er wurde zum Ehrenplatz an Gottes rechter Seite erhoben und erhielt von seinem Vater den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und was ihr hier seht und hört, ist die Wirkung dieses Geistes!“
Die Zuhörerinnen und Zuhörer waren von dem,. was Petrus sagte, bis in innerste getroffen und sie fragten Petrus, was sie jetzt tun sollten. Petrus antwortete: „Kehrt um und lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott eure Schuld vergeben und euch seinen Geist schenken.“
Viele ließen sich daraufhin taufen, so dass an diesem Tag etwa dreitausend Menschen zur Gemeinde hinzukamen.
Wenn wir Pfingsten als den Geburtstag der Kirche verstehen, dann müssten wir uns eigentlich fragen, welches Geschenk wir dem Geburtstagskind denn mitbringen könnten. Unsere Zeit vielleicht, unser Interesse, unser Geld? Das wären sicher mögliche Geschenke.
Was aber klar ist: Wir, die Geburtstagsgäste, bekommen auf jeden Fall an diesem Tag etwas geschenkt! Im Anschluss an die eigentliche Pfingsterzählung werden gleich vier solcher Geschenke aufgeführt:
Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet.
Das erste Geschenk besteht in der „Lehre der Apostel“. Sie, die Jünger Jesu (später wurde auch noch Paulus zu den Aposteln gezählt), mussten anfangs vermutlich nichts anderes tun, als zu erzählen, was sie von Jesus wußten. Und offenbar begriffen die Menschen plötzlich, dass die Geschichten von Jesus etwas anderes waren als die tausend anderen Geschichten, die sie täglich hörten. Es waren nämlich Geschichten vom Himmel, und es waren zugleich Geschichten vom Leben, ja es waren nicht zuletzt auch Geschichten vom ewigen Leben. Und während die Apostel den Menschen davon erzählten, ging der Himmel über ihnen auf.
Eine schwerhörigen Frau erzählte einmal, die Hörfähigkeit ihrer Ohren habe sich nach einer Operation „um acht Meter erhöht“. Bei manchen Patienten, so erzählte sie, habe die Operation nur eine Verbesserung „um zwei, drei Meter gebracht, bei anderen aber sogar um fünfundzwanzig Meter.“
So ging es wohl auch den ersten Christen in Jerusalem nach dem Pfingstfest: Plötzlich konnten sie hören, weiter hören als bisher in ihrem Leben, aber nicht nur einige Meter weiter, sondern sie konnten hören „bis zum Himmel“! Und dieser Himmel kam ihnen ganz nahe durch die Lehre der Apostel.
Das zweite Geschenk ist die Gemeinschaft, die die Christen untereinander hatten. Die junge Christengemeinde hatte am Pfingsttag eines verstanden: Man kann den persönlichen Glauben an Gott nicht loslösen von der Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen! Es gibt auf Dauer keinen Glauben ohne Kirche, Gemeinde oder Gemeinschaft, weil er sonst verkümmert. Christsein heißt, mit anderen teilen: Erfahrungen, Zweifel, Freude, Trauer, kurz: das Leben.
In einer solchen vom Glaube geprägten Gemeinschaft, konnten die Gemeindeglieder das Gegeneinander von Besitzenden und Besitzlosen nicht mehr ertragen. Und sie konnten das harte Nebeneinander von Hunger und Überfluss nicht mehr hinnehmen. Es war ihnen mit einem Mal unmöglich, das, was sie besaßen, nicht miteinander zu teilen. Kein anderer als der Geist Gottes konnte solch ein Wunder bewirken!
Welche Wunder brauchte unserer Zeit wohl am meisten? Und was müssten wir tun, um dem Geist Gottes dabei nicht im Weg zu stehen?
Das dritte Geschenk ist das Brotbrechen, wir würden sagen: das Abendmahl. Die ersten Christen feierten es täglich. Sie brauchten es auch täglich. Kein Tag verging ohne gemeinsames Mahl. Dieses Mahl war für sie ein „Essen und Trinken mit dem Herrn“. Ein Tag ohne die Mahlfeier war für sie deshalb wie ein Tag ohne den Herrn. Die Corona-Pandemie hat die Anzahl der Abendmahlsfeiern sehr stark reduziert. Langsam beginnt man nun wieder damit. Vorsicht ist geboten, aber wenn man diese Vorsicht walten lässt, können wir uns über das Geschenk des Abendmahls wieder freuen. Es erinnert uns an Jesu Leiden und Sterben, stärkt unsere Gemeinschaft und lässt und die Vergebung unserer Schuld spürbar werden.
Das vierte Geschenk ist das Gebet. Die Christen beteten damals anders als wir: intensiver, öfter, aber auch nicht so heimlich, wie wir es heute manchmal tun. Das Beten war ihn wichtig, weil für das Beten in gewissem Maß dasselbe gilt wie für das Christsein allgemein: Niemand kann es auf Dauer und ausschließlich allein. Zwar gibt es auch das Gebet im stillen Kämmerlein, und das ist gewiß sehr sinnvoll und hilfreich. Aber es tut auch gut, miteinander im Gebet verbunden zu sein, und sei es nur beim gemeinsam gesprochenen Vaterunser im Gottesdienst.
Das also sind Gottes Geburtstagsgeschenke an uns, seine Gemeinde: Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet.
Damit hat Gott seine Gemeinde damals reich beschenkt! Aber wie sieht es mit uns heute im Jahr 2023 aus? Die vier Geschenke sind auch Geschenke für uns, denn was Gott damals verschenkt hat, ist noch lange nicht „aufgebraucht“. Gottes Geschenke haben kein Verfallsdatum, sie halten eine Ewigkeit vor.
Der Kirche wird heute von Pessimisten ihr baldiges Ende vorausgesagt. Sicherlich muss sich die Kirche verändern, von Grund auf vielleicht. Aber sie wird weiterleben, trotz aller menschlichen Schwächen. Sie wird weiterleben, wenn Gottes „Geschenke“ nicht in Vergessenheit geraten, und wenn sie dem Geist Gottes Raum gibt. In dieser Zuversicht können wir getrost den Geburtstag unserer Kirche feiern!
Amen.
Himmelfahrt 2023
Text: Lukas 24, 50-52
Liebe Leserinnen und Leser,
Juri Gagarin war der erste Mensch im Weltraum: 1961 umrundete er in 108 Minuten die Erde. Zu seinen Ehren, so erzählte man sich damals, wurde in Moskau ein großer Empfang gegeben. In einem unbemerkten Augenblick nahm der damalige russische Ministerpräsident Chruschtschow den Helden des Tages beiseite und sagte: „Genosse, ganz ehrlich: Hast du da oben, du weißt schon was ich meine, hast du Ihn dort gesehen?“ „Ich habe ihn gesehen, Genosse.“
„Schlimm“, murmelte Chruschtschow, „aber halb habe ich mir das schon gedacht. Aber- du darfst auf keinen Fall jemandem ein Sterbenswörtchen davon sagen!“ Gagarin nickte.
Auch der Patriarch der orthodoxen Kirche war zu dem Empfang eingeladen. Kurze Zeit später nahm auch er Gagarin beiseite und flüsterte: „Mein Freund, sag mir ganz im Vertrauen: Hast du Ihn dort oben gesehen?“ „Nein“, sagte Gagarin befehlsgemäß. „Ach“, seufzte der Patriarch, „wie schade, aber halb habe ich mir das schon gedacht…“
In solchen Anekdoten steckt oft mehr Weisheit, als in mancher langen Rede. So ist es auch hier: Neben der auf den ersten Blick oberflächlichen, lustigen Seite der kleinen Szene gibt es mindestens zwei ganz ernsthafte Aspekte:
Zum einen können auch fromme Menschen Schwierigkeiten in Glaubensfragen haben, sie können unsicher werden und anfangen zu zweifeln. Und auch die Zweifler und Skeptiker sich ihrer Sache oft nicht wirklich sicher…
Zum anderen wird durch diese Anekdote auch deutlich, wenn es überhaupt noch einer Bestätigung bedürfen würde, dass es ausgeschlossen ist, mit technischen Mitteln etwas über die Existenz Gottes herauszubekommen oder ihn gar in dem Bereich, den wir „Himmel“ nennen, zu finden.
Der Name des heutigen Feiertages, Christi Himmelfahrt, hat sicher zu dem Missverständnis beigetragen, Gott sei an einem bestimmten Ort zu finden und der sei irgendwo über den Wolken. In anderen Sprachen gibt es mehrere Übersetzungsmöglichkeiten für das deutsche Wort „Himmel“. Im Englischen etwa stehen dafür die Worte „sky“ und „heaven“. Warum ist das so? Weil mit dem Wort „Himmel“ zwei ganz unterschiedliche Dinge gemeint sind, zum einen tatsächlich der Bereich „über den Wolken“, zum andern aber der Bereich der Gegenwart Gottes.
Himmelfahrt bedeutete demnach nicht, dass Jesus irgendwo in der Stratosphäre zu finden sei. Aber was bedeutet es dann?
Im Lukasevangelium wird die Himmelfahrt Christi wie folgt „beschreiben“:
Jesus führte seine Jünger bis in die Nähe von Betanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen.
Während er sie noch segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben.
Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt.
Die Jünger müssen Abschied von Jesus nehmen, das ist nicht leicht für sie. „Abschied ist ein bißchen wie sterben“, sang einst Katja Ebstein in dem gleichnamige Lied und das Volkslied behauptet „Scheiden tut weh…“, Scheidungen noch mehr, der Seele und dem Geldbeutel, es gibt Abschiede auf Zeit und solche ohne Wiederkehr.
Jesus trennt sich von seinen engsten Anhängern. Trauer und Tränen müssten eigentlich die Reaktion sein, schließlich haben die Jünger ihren „Meister“ ja doch geliebt und verehrt. Lukas schreibt aber, dass die Jünger „von großer Freude erfüllt“ nach Jerusalem zurückkehrten. Wieso? Lag es allein an der Verheißung des Heiligen Geistes, den Jesus ihnen versprochen hatte?
Vielleicht haben die Jünger in diesem Moment auch noch nicht wirklich realisiert, was es bedeuten würde, wenn Jesus nicht mehr da wäre. Möglich wäre es aber auch, dass sie Jesus einfach „nur“ vertraut haben, hatten sie doch schon so oft Wunderbares mit ihm erlebt. Da musste er doch auch in der Zukunft Gutes für sie bereithalten.

Wer Christus bzw. seinem himmlischen Vater vertraut, der kann auch heute fröhlich darauf hoffen, dass eine gute Zukunft für ihn bereitsteht. Darum sind die Jünger bei allem Abschiedsschmerz fröhlich. Gustav Heinemann, der dritte Bundespräsident Deutschlands, hat einmal gesagt: „Die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt!“ So haben es die Jünger vielleicht auch gesehen. Denn was da geschah, als Christus in den Himmel aufgenommen wurde, das hatte noch eine ganz andere Bedeutung als nur „Abschied“: Vermutlich erinnern Sie sich noch gut an die feierliche Krönung von Charles III zum neuen britischen König. Sie fand am 6. Mai 2023 in der Westminster Abbey statt, ein Riesenereignis, dem Millionen Menschen an den Fernsehgeräten beiwohnten. In ähnlicher Weise wir am Himmelfahrtstag Christus zum Herrscher eingesetzt, aber nicht zum Herrscher über das britische Empire, sondern zum Herrn der Welt. Dadurch, dass er auffährt in den Himmel, also in den Bereich Gottes, wird er von Gott bestätigt als sein Sohn: „Jesus Christus herrscht als König…“, singt die Gottesdienstgemeinde nun. Der, der gerade noch am Kreuz den Verbrechertod starb, wird nun von Gott anerkannt, seine Königsherrschaft beginnt. Deshalb freut sich die Christenheit an diesen Tag!
Zugleich erinnert diese Königsherrschaft Christi aber auch an seinen Herrschaftsanspruch in allen Bereichen unseres Lebens: im Bereich der Arbeit und der Freizeit, im Alltag und am Sonntag, in der Freizeit und der Politik.
Das Himmelfahrtsfest hat aber noch einen weiteren Aspekt, und der hat mit Gottes Unverfügbarkeit zu tun. Jesus wurde oft von Menschen bedrängt, die etwas von ihm wollten, die ihn etwa zu einem weltlichen König machen wollten oder zu einem Führer im Aufstand gegen die Römer.
Vom Himmelfahrtstag an ist es deutlich und eindeutig, dass wir Jesus in dieser Form nicht mehr zur Verfügung haben, dass wir ihn nicht mehr ohne Weiteres vor unseren Karren spannen können. Er ist und bleibt unverfügbar für jeden, der ihn für seine Zwecke missbrauchen will. Als Zeichen solcher Unverfügbarkeit werden am Himmelfahrtstag in manchen Gemeinden sogar die Osterkerzen gelöscht…
Nicht zuletzt geht es am Himmelfahrtstag um Grenzüberschreitungen. Grenzen engen den Menschen ein. Viele Grenzen von früher sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten verschwunden, z. B. im Bereich der Mode oder der Moral. Andere Grenzen bleiben bestehen oder werden sogar neu aufgerichtet: zwischen Arm und Reich, Ost und West, Russland und der Nato, um nur einige Beispiele zu nennen. Himmelfahrt macht deutlich: Für das Wirken Jesu gibt es keine Grenzen, nichts kann ihn einengen, sein Wille soll geschehen „wie im Himmel, so auf Erden“. Am Himmelfahrtstag segnet Jesus seine Jünger, und diejenigen, die er segnet, gehören schon jetzt in den Bereich dieses Gottes und dürfen für Andere zum Segen werden.
Vielen Menschen feiern an Christi Himmelfahrt nur noch den „Vatertag“. Als Vorwand für Trinkgelage ist das sehr traurig, aber man könnte vielleicht Vatertag im geistlichen Sinn feiern: Am Himmelfahrtstag hat Gott, unser himmlischer Vater, seinen Sohn zu sich genommen und damit bestätigt, dass das Wesen Jesu sein Wesen ist, die Liebe Jesu seine Liebe, die Taten Jesu seine Taten. Der Vater lässt seinen Sohn zum Segen für uns alle werden. In diesem Sinne kann man an „Christi Himmelfahrt“ auch Vatertag feiern…
Amen.
Rogate 2023

Liebe Leserinnen und Leser,
vor einer Woche hat ein Angreifer in der texanischen Stadt Allen acht Menschen getötet, darunter Kinder. Vorfälle dieser Art kommen in den USA häufig vor und die politischen Reaktionen sind Routine geworden. So twitterte der texanische Senator Ted Cruz: „Meine Frau Heidi und ich beten für die Familien der Opfer dieses grausamen Angriffs.“ Ein Befürworter schärferer Waffengesetze schrieb daraufhin: „Du hast doch geholfen, ihn zu bewaffnen. Du hast genau gewusst, was er tun würde. Erspar uns deine Gebete…“
Diese Reaktion ist auf dem Hintergrund zu verstehen, dass sich der Senator kurz vorher über einen Politiker lustig gemacht hatte, der Kritik an den laxen Waffengesetzen in Texas geäußert hatte, und dass er angeblich Hunderttausende Dollar von Organisationen erhalten hatte, die sich für schwache Waffengesetze einsetzen. (laut Spiegel-online vom 8. 5. 2023)
Wer das hört, könnte meinen, dass das Gebet in diesem Fall vom eigentlichen Problem ablenken sollte und nicht mehr als ein Floskel war. Aber nur deshalb, weil jemand ein Gebet missbraucht und es offenbar nicht mit seinem Leben und seinen Taten übereinstimmt, muss man das Beten ja nicht grundsätzlich ablehnen. Was hat es also mit dem Beten auf sich und worum geht es, wenn wir uns im Gebet an Gott wenden?
Der Evangelist Lukas berichtet, dass die Jünger Jesu vor ähnlichen Fragen standen und sie Jesus eines Tages baten, ihnen Anweisungen für das Beten zu geben. Als Beispiel für ein gutes Gebet nannte Jesus ihnen das Vaterunser. Aber er erzählte den Jüngern auch eine Geschichte über das Beten:
Angenommen, du hast einen guten Freund. Mitten in der Nacht sucht er dich auf und fragt: „Kannst du mir bitte ein paar Scheiben Brot leihen? Ein Bekannter von mir hat auf seiner Reise unerwartet bei mir Halt gemacht, und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte.“ Und angenommen, du riefest dann von drinnen: „Lass mich doch in Ruhe! Die Tür ist abgeschlossen und wir sind alle längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben.“ Ich sage dir: Du wirst es schließlich doch tun und ihm geben, was er braucht, wenn nicht um eurer Freundschaft willen, dann weil er dir keine Ruhe lässt.
Voraussetzung, einen solche Situation zu erleben, ist erst einmal, überhaupt einen Freund oder eine Freundin zu haben, ansonsten kann man die Geschichte kaum nachvollziehen.
Freunde zu haben ist wichtig, nicht nur, um sich nachts ein paar Schnitten Brot oder eine Flasche Bier borgen zu können. Freundinnen und Freunde sind da, um reden zu können, um neue Einsichten zu gewinnen, um Helfer in der Not zu haben. Unser Leben wird reicher durch wahre Freundschaften.
Haben wir eigentlich genug Freunde oder Freundinnen?
Und sind wir für Andere gute Freunde oder Freundinnen?
Und in der Gemeinde, sind wir da gute Freunde füreinander?
In der Geschichte Jesu geht es in besonderer Weise um die Beharrlichkeit des Freundes. Er lässt nicht locker, bittet immer wieder um Hilfe, bis es dem Anderen schließlich zu bunt wird und er die nächtliche Bitte erfüllt. Vielleicht können wir aus der Beharrlichkeit des Freundes etwas über das Betens lernen: Nicht so schnell aufzugeben, nicht den schnellen „Erfolg“ jetzt und sofort zu suchen. Tatsächlich ist der Rat, den Jesus seinen Jüngern bezüglich des Betens gibt, ganz nahe bei dem beharrlichen Freund:
Bittet und es wird euch gegeben;
sucht, und ihr werdet finden;
klopft an, und es wird euch geöffnet.
Denn wer bittet, der empfängt,
wer sucht, der findet,
und wer anklopft, dem wird geöffnet.
Bitten, suchen, anklopfen, alles drei Tätigkeitsworte, das klingt nach Aktion, nach Taten, jedenfalls nicht danach, die Hände in den Schoß zu legen und Gott alles machen zu lassen. Beten ist noch nie ein Ersatz für das eigene Tun gewesen, im Gegenteil: Jochen Klepper stellt in seinem Lied „Der Tag ist seiner Höhe nah“ den richtigen Zusammenhang her: „Die Hände, die zum beten ruh’n, die macht er (Gott) stark zur Tat.“

Beides gehört untrennbar zusammen: aktive Weltgestaltung und das Gebet. Ganz ähnlich klingt das bekannte Motto des Benediktinerordens: ora et labora, bete und arbeite.
Wie ein Freund wird sich Gott freuen, uns helfen zu können, nicht aber unsere Arbeit zu machen. Und wie ein Freund ist Gott kein Automat, in den wir oben unsere Wünsche hineingeben und unter die Erfüllung herauskommt.
Um was aber dürfen wir Gott bitten? Grundsätzlich um alles, auch um die kleinen Dinge im Alltag, um Kraft und Mut für unserer Aufgaben, um Fantasie und gute Nerven bei den Kindern, am Arbeitsplatz oder in der Schule. Es hilft schon, wenn ich mir darüber klarwerde, dass ich Gott meine Sorgen anvertrauen darf und natürlich auch das, was mich froh macht. Und es verändert mich, wenn ich bete: Da drängelt hinter mir ein Porsche auf der Autobahn, ich fühle mich unsicher, fahre schneller als gewollt, mein Blutdruck steigt. Wenn der Fahrer endlich an mir vorbeizieht, kann ich eine Fluch ausstoßen, was aber meist nicht viel ändert. Wenn ich aber Gott bitte: Lass auch ihn gesund zu Haus ankommen, dann hat sich in mir schon viel verändert. Da ist kein Hass mehr, allenfalls noch Unverständnis über so viel Rücksichtslosigkeit.
Aber das Gebet muss sich darauf nicht beschränken. Martin Luther schreibt.
„Ein Tor ist der, die einen königlichen Wunsch frei hat, und sich eine Bettlersuppe wünscht.“
Dürfen wir Gott also bitten um den Weltfrieden? Ja aber das darf uns nicht davon abhalten, uns um ein friedliches Miteinander zu bemühen.
Dürfen wir um die Bewahrung der Schöpfung bitten? Ja, aber das darf uns nicht davon abhalten, schon hier und jetzt zu tun, was wir dafür tun können.
Dürfen wir um volle Gottesdienste bitten? Ja, aber das darf uns nicht davon abhalten, alles was in unserer Macht steht dafür zu tun, dass sie einladend und offen sind.
Zum Schluss steigert Jesus das Bild von einem Freund durch das Bild von einem Vater, von seinem Vater:
Welcher Vater würde seinem Kind wohl eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bäte? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bäte? Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist geben?!
Das Vertrauen von Kindern zu ihren Eltern ist in der Regel fast unbegrenzt. Durch die Worte Jesu werden wir eingeladen, ein solches Vertrauen auch zu Gott zu wagen. Jesus sagt uns zu, wenn wir Gott darum bitten würden, würde er uns den Heiligen Geist geben. Vermutlich wären unsere Bitten eher in die Richtung Freude, Frieden im Herzen, Zufriedenheit, vielleicht Gesundheit.
Aber Gott will uns seinen Geist schenken. Das ist vermutlich mehr, als wir zu bitten gewagt hätten. Gottes guter Geist ist schließlich die Art, wie er unter uns und bei uns sein will. Der Geist Gottes kann unser Tun und Reden beflügeln. Durch diesen Geist und in diesem Geist können wir die Welt und unser Leben im Sinne Jesu und seines himmlischen Vaters gestalten. Nicht weniger als diesen Geist, nicht weniger als sich selbst will Gott also denen geben, die darum bitten. Welch große Verheißung!
Amen.
Kantate 2023
Liebe Leserinnen und Leser,
wenn man die meiste Zeit seines Lebens zwischen Westerwald und Siegerland zugebracht hat, weiß man, was Wasser bedeutet: häufige Regenfälle, manchmal unerwartet starker Regen, Bäche und Flüsse, die über die Ufer treten usw. Dennoch hat sich meine Einstellung zum Wasser, seitdem unser Lebensmittelpunkt unmittelbar an der Nordsee liegt, grundlegend geändert. Das Wasser, von oben, von unten und vom Meer her, hat hier eine ganz andere, eine existenzielle Bedeutung für die Menschen:
Wir wohnen einen halben Meter unter dem Meeresspiegel, wären die Deiche nicht da, wäre hier alles überschwemmt. Dasselbe würde passieren, wenn das Land hier nicht ständig entwässert würde. Um die Grundstücke herum sind seit Generationen Gräben gezogen worden, über deren Bedeutung ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe. Sie sind lebensnotwendig für die Entwässerung dieser Gegend und notwendig für Vieh und Fische.
Dort, wo ich jetzt wohne, ist früher einmal Wasser gewesen, das Land haben die Menschen dem Meer abgerungen, große Sturmfluten haben das Land zuvor zerklüftet und Zehntausenden Menschen den Tod gebracht.
Und was es für die Zukunft bedeutet, dass der Meeresspiegel immer weiter ansteigt, ist noch nicht absehbar.
Und doch wird Wasser zum Leben gebraucht für Menschen, Tier und Pflanzen. Die Trockenperioden, die Europa schon in diesem Jahr heimgesucht haben, legen Zeugnis ab von er Wichtigkeit und Notwendigkeit von Wasser. Und vielleicht werden wir Wasser zukünftig auch dazu brauchen, um unsere Moore zu vernässen, um etwas und für den Klimaschutz zu tun…
Wasser ist also zu mindestens an der Nordseeküste etwas, das Leben der Menschen maßgeblich bestimmt.
 In der Bibel wird von einem Mann erzählt, dessen Leben von Anfang bis Ende vom Wasser bestimmt war, nämlich von Mose:
In der Bibel wird von einem Mann erzählt, dessen Leben von Anfang bis Ende vom Wasser bestimmt war, nämlich von Mose:
Als Mose, der Israelit, in Ägypten geboren wurde, gab es dort grausame Menschen, die der Meinung waren, es gäbe zu viele kleine israelische Jungen. Sie ließen sie daher einfach umbringen. Da sagte sich die Mutter von Mose: „Ich muss den Kleinen verstecken, damit sie ihm nichts antun können!“ Sie schnitt am Ufer eines Flusses Schilfgräser ab und machte daraus ein kleines Körbchen mit einem Deckel. Die untere Seite verschmierte sie mit Pech, damit kein Wasser eindringen konnte. Dann legte sie den kleinen Moses in das Körbchen, verschloss es mit dem Deckel, setzte das Körbchen mit dem Kind auf das Wasser und flüsterte: „Gott, dir vertraue ich nun mein Kind an, beschütze es!“ Da erlebte der kleine Junge zum ersten Mal, dass Wasser ihn trug.
Das Körbchen schwamm langsam dahin, bis zu einer schönen grünen Wiese. Dort spielte eine Königstochter mit ihren Freundinnen. Plötzlich entdeckten sie das Körbchen. Als sie aus dem Körbchen ein leises Weinen hörten, fischten sie das seltsame Schiffchen aus dem Wasser und sagten: „Weil wir ihn aus den Wasser gezogen haben, soll er ‚Mose‘ heißen.“ „Mose“ bedeutete nämlich in der Sprache jener Mädchen so viel wie „aus-dem-Wasser-gezogen“.
Jahre vergingen, Mose war ein Mann geworden, aber immer noch gab es Menschen, die andere quälten, die vor allem die Israeliten bedrückten und unterjochten. Da sagte Mose eines Tages zu den unterdrückten Menschen: „Ich will nicht, dass ihr das noch länger ertragen müsst! Lasst uns in ein fernes Land fliehen, das Gott uns schenken will.“ „Wie sollen wir entkommen?“ sagten die Gequälten, „An der Grenze ist ein großes Wasser. Wie sollen wir da hindurch kommen?“ Mose antwortete: „Gott hat gesagt: ‚Fürchte dich nicht, wenn Du durchs Wasser musst, will ich bei dir sein, dass dich die Fluten nicht ertränken sollen.‘“ Und so geschah es: Sie zogen durchs Wasser- und die Wasserfluten konnten ihnen nichts anhaben. Die grausamen Verfolger aber ertranken in den Fluten.
Jenseits des großen Wassers war eine trockene Wüste.
Viele Tage lang wanderten die geflohenen Israeliten und litten in der Hitze furchtbaren Durst. „Wenn wir überleben wollen, brauchen wir Wasser!“, seufzten sie. Mose antwortete: „Gott kann uns Wasser des Lebens schenken, auch mitten in der Wüste.“ Er schlug mit seinem Stab an einen Felsen, da sprudelte Wasser hervor. Sie schöpften mit beiden Händen und tranken das „Lebenswasser“ in vollen Zügen.
Der Weg durch die Wüste wurde immer beschwerlicher, aber schließlich sahen die Menschen das Ziel ihres Weges, das Land, das Gott ihnen schenken wollte. Grüne Wiesen gab es da, bunte Blumen, Kornfelder, Weinberge, Schafe und Kühe. Da freuten sich die Menschen, nun endlich am Ziel zu sein!
Soweit die Wassergeschichte von Mose. Viele Jahrhunderte später traf Jesus einmal an einem Brunnen eine Samariterin. Er bat sie um etwas Wasser, aber sie tat sich schwer damit. Das sagte Jesus zu ihr: „Wenn du wüsstest, wer es ist, der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wer das Wasser hier aus dem Brunnen trinkt, der wird bald wieder durstig. Wer aber vom Wasser des Lebens trinkt, das ich ihm geben werde, der wird nie mehr Durst haben.“

Einen guten alten schottischen Whisky zu trinken ist für Kenner ein schönes, wenn auch teures Vergnügen, und man muss es mit Ruhe und Muße tun.
Was aber hat das mit dem Lebenswasser von Mose und dem Wasser des Lebens bei Jesus zu tun?
Sehr viel, denn „Wasser des Lebens“ war für die Lateiner der Name für destillierten Alkohol. Im gälischen Sprachraum, zu dem Schottland gehört, wurde daraus „uisge beatha“. Daraus entstand im Laufe der Zeit das Wort WHISKY.
Whisky heißt also nichts anderes als „Wasser des Lebens“. Das Wasser des Lebens, das Christus uns gibt, ist im Gegensatz zum Whisky „kostenlos“, aber Gott hofft, dass es nicht „umsonst“ ist, wenn er uns dieses Wasser anbietet, denn es kann unsere Seele heil machen.
Das Wasser des Lebens ist Gottes Gegenwart, sein guter Geist, seine Güte und Freundlichkeit, die uns jeden Tag umgeben will.
In manchen irischen Bars soll ein Schild hängen, das einlädt auf ein Glas Whisky, den Besucher aber ermahnt, daran zu denken, dass es noch ein anderes „Wasser des Lebens“ gibt…
Ein guter Rat, wie ich finde.
Amen.
Jubilate 2023
Text: Genesis 2, 1-4 i. A
Liebe Leserinnen und Leser,
in Berlin hat es am Donnerstag wieder einmal eine Wahl gegeben. Als Zyniker könnte man sagen, es sei keine Überraschung, dass es dabei wieder zunächst schiefgegangen sei: Obwohl die „große“ Koalition aus CDU und SPD eine Mehrheit im Senat hat, wurde ihr gemeinsamer Kandidat erst im dritten Wahlgang zum regierenden Bürgermeister gewählt. Mir steht noch deutlich ein Bild des Gewinners und der Gewinnerin vor Augen, des Bürgermeisters und seiner Stellvertreterin. Beide verkörperten darauf genau das Gegenteil von dem, was man ausdrücken möchte, wenn man sagt: „So seh’n Sieger aus…“ Ein verkniffenes Lächeln gab es, das den Wunsch auszudrücken schien, dass dieser Tag möglichst bald vorbei sein möge.
Ich beneide niemanden, der in eine solche Situation gerät. Das Bild der beiden hat sich bei mir vor allem deshalb verfestigt, weil ich denke, dass es in mancher Hinsicht dem Osterlachen der Christenheit ähnelt. Wir leben ja in der Nach-Osterzeit und begehen heute den Sonntag Jubilate. Das muss man nicht lange übersetzen, es bedeutet: jubelt, schreit eure Freude hinaus, zeigt eure Begeisterung.
In manchen katholischen Kirchen ist es üblich, dass der Priester zu Ostern einen Witz erzählt. Es wird dabei in der Kirche wenigstens einmal gelacht, das ist nicht schlecht, aber dass man Witze braucht, um die Fröhlichkeit des Oster-Glaubens zum Auszug zu bringen, ist eigentlich eher traurig.
Dabei es für uns Christen neben dem Osterglauben auch noch andere Dinge, über die wir uns freuen könnten, über die wir eigentlich jubeln müssten: Es vergeht kein Tag, in dem nicht über das Thema „Klima“ gesprochen wird. Ich halte das Thema für ausgesprochen wichtig, betrifft es doch nicht nur uns, sondern auch unsere Kinder und Enkel. Als Rentner bin ich in dieser Frage sowohl im politischen als auch im kirchlichen Bereich unterwegs. Das Ziel ist das gleiche, die Erhaltung und Bewahrung der Welt, aber während wir im politischen Bereich von der Umwelt reden, sprechen wir im kirchlichen Bereich von der Schöpfung. Wir tun dies, weil wir der Überzeugung sind, dass wir unser Leben Gott verdanken. Es geht um nichts weniger als um die Frage, ob wir ein Produkt des Zufalls sind oder ob wir von Gott gewollt sind.
Die Bibel, erzählt davon, dass Gott die Welt geschaffen habe und das alles, was er gemacht habe, im Ursprung sehr gut gewesen sei: das Licht und die Sterne, Sonne und Mond, das Meer, die Pflanzen und Tiere und nicht zuletzt der Mensch. Vom sechsten Tag, als auch die Tiere und der Mensch geschaffen wurden heißt es etwa:
Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.
Die Menschen, die das niedergeschrieben haben, waren Gott offenbar sehr dankbar für sein Schöpfungswerk. Diese Dankbarkeit fehlt uns heute oft, weil viele Menschen nicht mehr an einen Schöpfer glauben. Als Christen glauben wir dagegen, dass wir von Gott gewollt sind. Es ist nicht entscheidend, wie das geschehen ist, sondern entscheidend ist allein die Tatsache, dass Gott uns als sein Gegenüber gewollt hat.
Aber zurück zum ersten Schöpfungsbericht. Man könnte meinen, die Erschaffung des Menschen sei der Höhepunkt der Schöpfung und damit sei sie nun beendet. Das erste Kapitel der Bibel endet auch tatsächlich an dieser Stelle. Aber damit ist die Schöpfung glücklicherweise noch nicht beendet. Im zweiten Kapitel der Bibel wird sie fortgesetzt mit den Worten:
Am siebten Tag vollendete Gott seine Schöpfung und ruhte an diesem Tag aus von allen seinen Werken. Und Gott segnete und heiligte den siebten Tag, weil er an ihm von allem, was er geschaffen hatte, ausruhte.

Man mag sich nicht vorstellen, wie es wäre, wenn alle Tage unseres Lebens immer wieder gleich ablaufen würden. Ohne Unterbrechung und Veränderung wäre das Leben eintönig und leer. Ohne Sonntag gäbe es nur Werktage, einer wäre wie der andere. Eine schreckliche Vorstellung.
Dass der Sonntag ein wertvolles Geschenk ist, haben die Kirchen im Jahr 2007 folgendermaßen ausgedrückt:
„Der Sonntag ist ein wertvolles Geschenk für alle Menschen, Woche für Woche wiederkehrend, verlässlich wie Tag und Nacht, Abend und Morgen. Er gibt dem gesellschaftlichen Leben den notwendigen Zeitrhythmus. Leben ist mehr als kaufen und verkaufen, produzieren und konsumieren, leisten und schuften, daran erinnert uns der Sonntag. Er unterbricht den Alltag zum Ausspannen und Aufatmen. Er schafft freie Zeit und Freiraum für Muße und für die Fragen nach Grund und Perspektiven des Lebens und des Zusammenlebens.“
Unser Leben braucht Strukturen, braucht Abwechslung. Der Sonntag ist kein Gebot, das uns einengt, sonder er unterbricht den Alltag, um auszuspannen, um aufzuatmen, um aufzutanken. Er bedeutet einen Freiraum für Familie, Erholung, gemeinsames Erleben von freier Zeit und nicht zuletzt die Möglichkeit, über die wichtigen Fragen des Lebens nachzudenken.
Ein Spötter schrieb an den gläubigen Schriftleiter einer Tageszeitung:
„Geehrter Herr! Dieses Jahr habe ich einen beachtenswerten Versuch unternommen. Im Frühjahr habe ich jeden Sonntag gesät, anstatt in die Kirche zu gehen. Im Sommer habe ich jeden Sonntag auf dem Felde gearbeitet, und im Herbst jeden Sonntag geerntet. Meine Ernte ist wesentlich besser als die meiner Nachbarn, die jeden Sonntag in die Kirche liefen. Was sagen Sie dazu?“
Der Schriftleiter veröffentlichte den Brief und schrieb darüber: „Gott begleicht seine Rechnung nicht immer im Oktober.“[1]
Wie ist das gemeint? Sicher nicht so, dass Gott den Menschen am Ende für sein Tun bestrafen wird. Aber vielleicht so: Es kommt di Zeit, da wirst du merken, dass Arbeit und Profitstreben ohne Unterlass am Ende nicht glücklich macht, sondern krank. Der Spiegel veröffentlichet vor gut einer Woche ein Interview mit einem Finanzexperten unter der Überschrift: „Der reichste Mensch auf dem Friedhof? Das ist ein furchtbarer Lebensentwurf.“
Die Unterbrechung der Arbeit durch den Sonntag richtet sich dagegen, im Leben immer nur nach wirtschaftlichen Maßstäben zu handeln. Nicht Kaufen und Verkaufen, Produzieren und Konsumieren halten die Welt in Gang, sondern Gott und Menschen, die sich in Verantwortung vor ihm sehen und sich als seine Geschöpfe verstehen.
Nachdem Gott die Welt erschaffen hatte, gönnte selbst er sich eine Zeit der Ruhe. Und so darf es der Mensch auch handhaben. Im zweiten Buch der Bibel (Exodus 34, 21) heißt es:
„Sechs Tage sollst du arbeiten und alle dein Werke tun. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des HERRN, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremde, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der HERR Himmel und Erde gemacht… und ruhte am siebten Tage.
Die sonntägliche Ruhe bringt uns zur Besinnung und macht uns deutlich, dass wir selbst bei ununterbrochener Leistung, wenn das überhaupt ginge, nicht alles erreichen könnten. Der Sonntag ist die freie Zeit, in der ein sonst immer tätiger Mensch zum Empfangenden werden kann, wo er sich von Gott beschenken lassen kann. Auch die Gemeinschaft in der Familie und unter Freunden ist ein solches Geschenk, das am besten gelingt, wenn möglichst alle einen gemeinsamen Tag der Arbeitsruhe haben. Der Sonntag ist also allemal ein Grund zum Jubilieren, zumindest aber zur Dankbarkeit.

Nun feiern Christen ja nicht den siebten Tag der Woche, sondern den Sonntag, nach christlichem Verständnis also den ersten Tag der Woche. Sie tun dies, weil an diesem Tag Christus vom Tod auferstanden ist. Damit ist für Christen die Zuversicht verbunden, dass der Tod nicht das letzte Wort in dieser Welt haben wird. In jedem sonntäglichen Gottesdienst werden wir an Ostern erinnert, den Neuanfang des Lebens durch die Auferstehung Jesu Christi. Jeder Sonntag, so sagt man, ist wie ein kleines Osterfest.
Die Stellung des Sonntags in der Gesellschaft ist im Schwinden. Die gesetzlichen Bestimmungen des Ladenschlussgesetzes werden immer mehr abgeschwächt, oft werden sie durch mancherlei Tricks ausgehebelt. Die weltweiten Wirtschaftsbeziehungen weichen den Sonntag in vielen Bereichen zusätzlich auf.
Der Predigttext lädt uns dazu ein, über die Gabe des Sonntags nachzudenken, darüber zu „jubeln“ und uns für den Erhalt des Sonntags einzusetzen.
Amen.
[1] Hoffsümmer, Kurzgeschichten

